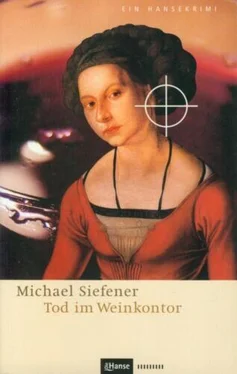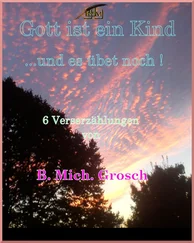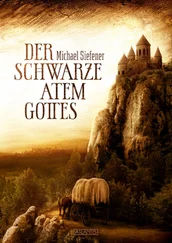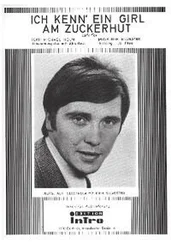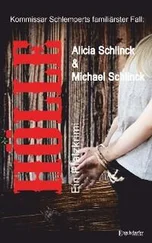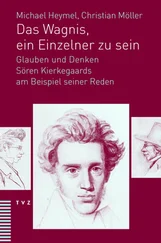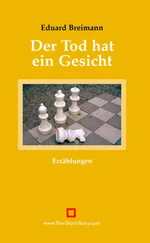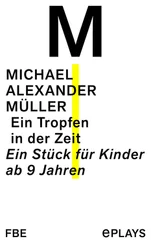Er betrachtete sie kurz. Der getrocknete Lehm hatte ihrem schönen grünen Kleid hässliche Schlieren aufgedrückt. Nun war sie ein Kind der Erde und des Himmels zugleich. Andreas wunderte sich über seine seltsamen Gedanken. Rasch sagte er: »Es wäre doch möglich, dass der Mord an Ludwig geschäftliche Hintergründe hat.«
»Warum?«, wollte Elisabeth wissen, der sein inniger Blick wohl nicht entgangen war, denn sie machte sich von ihm los.
»Hatte Ludwig Feinde? Gab es Leute, die ihm sein kaufmännisches Geschick neideten? Vielleicht wisst Ihr, dass Köln im Augenblick unter der Verhansung, also dem Ausschluss aus dem Bund der Hanse, leidet – mit Ausnahme jener Kaufleute, die gute Geschäfte mit England machen. Als Weinhändler war Ludwig einer der Gewinner; Barbara Leyendecker hat von überall her die letzten Weinreserven aufgekauft, um sie in England zu vergolden. Vielleicht gibt es in dieser Richtung ein Motiv?«
Elisabeth öffnete den Mund; es hatte den Anschein, als wolle sie Andreas vehement widersprechen. Doch sie sagte nichts, sondern setzte den Weg fort. Schweigend gingen sie über den Heumarkt, kamen an der verwaisten erzbischöflichen Münze vorbei und näherten sich dem Rhein. Als sie in die Rheingasse einbogen, brach Elisabeth endlich das Schweigen.
»Ja, da gibt es eine Sache, die Ihr vielleicht wissen solltet«, sagte sie zögerlich. »Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen, denn ich will das Andenken meines Bruders nicht in den Schmutz ziehen.«
Nun war es an Andreas, ihr einen fragenden Blick zuzuwerfen.
Sie fuhr fort: »Es gibt einen Weinhändler namens Johannes Dulcken, den Ludwig aus dem Englandhandel gedrängt und der ihm deshalb ewige Feindschaft geschworen hat.«
»Und das sagt Ihr mir erst jetzt?«, rief Andreas barscher, als er gewollt hatte. »Ihr habt mich möglicherweise auf eine falsche Fährte angesetzt.«
»Bitte regt Euch nicht auf. Ich bin immer noch der Meinung, dass Ludwigs Frau schuld an seinem Tod ist: Dieser Dulcken hatte schlechten Wein verkauft, und das zu überhöhten Preisen. Also hat er sich sein Elend selbst zugefügt. Ludwig erzählte mir einmal, dass Dulcken, der sein ärgster Konkurrent war, zu gierig geworden sei und gepanschten Wein angeboten habe, um seinen Gewinn zu vergrößern. Er hatte guten mit schlechtem Wein versetzt, Alaunsteine in die Fässer gehängt, Blut oder Eiweiß hinzugefügt, wenn die Farbe nicht nach seinem Willen war, und manchmal Zucker oder Rosinen beigegeben.«
»Es ist doch üblich, den Wein zu würzen«, meinte Andreas.
»Nicht, wenn man ihn verkauft. Nach dem eigenen Geschmack bereitet ihn erst der Kunde in seiner eigenen Küche zu. Bei der Lieferung aber muss er rein und vollkommen sein. Dulcken hat sich daran nicht gehalten und ist Opfer seiner Habgier geworden.«
»Wo finde ich diesen Dulcken?«, fragte Andreas, als sie bereits vor dem Bonenberger Haus mit seinen großen Blendarkaden und dem hohen Backsteingiebel standen.
»In der Vorhölle«, flüsterte Elisabeth, bevor sie die Stufen hinaufschritt.
In der Nacht hatte Andreas schlecht geschlafen. Er war in die Hölle hinabgestiegen und hatte dort Johannes Dulcken getroffen. Dieser saß blutend auf einem langen Sägemesser und wollte keinen Ton sagen. Da kam ihm Barbara Leyendecker entgegen, lächelte ihn an, und aus ihrem Mund kroch eine Schlange. Elisabeth stand neben ihrem Bruder. Beide hatten am ganzen Körper Augen – Augen, die ausnahmslos schreckgeweitet waren. Andreas erwachte mit einem Schrei.
Die Glocken schlugen die fünfte Stunde. Rasch zog er sich an und huschte mit einer Laterne in der Hand hinüber in die dunkle Kirche, um die Frühmesse zu zelebrieren. Deutlicher denn je wurde ihm an diesem Morgen bewusst, dass das Gotteshaus eine riesige Baustelle war. Überall befanden sich Gerüste und Abdeckungen, doch schon seit Wochen arbeitete niemand mehr hier. Es gab Schwierigkeiten mit den Materialien, mit den Knechten und Meistern. Pastor Hülshout hatte neue Meister eingestellt, die aber zunächst die Bauzeichnungen studieren mussten. Vielleicht würde es ja niemals weitergehen. Vielleicht steckten sie alle in ihrem kleinen Leben fest, das auch eine Baustelle war, an der oft niemand zu arbeiten schien – nicht einmal Gott, von dem Andreas manchmal befürchtete, er interessiere sich nicht sehr für die kleinen Belange seiner Kinder.
Nach der gut besuchten Frühmesse machte sich Andreas Bergheim auf den Weg in die Vorhölle.
Elisabeth hatte ihm auf seine Nachfrage hin erklärt, Johannes Dulcken habe sein Handelshaus und damit auch seine Wohnstatt verloren und friste sein Dasein nun als fliegender Krämer am Neumarkt. Sie hatte ihn Andreas kurz beschrieben – klein, sehr dick, wulstige Lippen, das rechte Bein nachziehend.
Andreas nahm den Weg durch die Herzogstraße zur Schildergasse und folgte ihr, bis er auf den Neumarkt stieß. Die großen Linden warfen grüne Schatten auf das Vieh, das heute hier zum Verkauf angeboten wurde. Er ging am Rande des Platzes vorbei. Ihm reichte schon das Blöken, Meckern, Gackern, Wiehern und Schnauben. Mit den Urhebern dieser Laute wollte er keinesfalls nähere Bekanntschaft machen; außerdem war der Platz an Markttagen nicht unbedingt ein Ort angenehmer Gerüche. Es widerte Andreas an, die vielen Schweine sich in den Gassen und auf den Straßen suhlen zu sehen. Zwar war es verboten, dieses Vieh durch die Straßen zu treiben, doch kaum jemand hielt sich daran. So kam ihm auf der Höhe der Fleischmengergasse, in der sich Kleinhändler mit geringwertigen Fleischwaren angesiedelt hatten, eine wild gewordene, wie der Teufel quiekende Sau entgegen, der er nur durch einen beherzten Sprung in den Kot auf der Straße ausweichen konnte. Dem armen, verängstigten Tier setzte eine groteske Gestalt nach. Zuerst glaubte Andreas, es sei eine laufende Vogelscheuche, doch es schien tatsächlich ein Mensch zu sein. Er trug Fetzen am ganzen Körper, und auch seine Kopfbedeckung bestand aus nichts als Stoffresten, die von einer einheitlich braunen Lehmschicht überzogen waren. Der kleine Mann zog das rechte Bein nach, sodass er an den Gottseibeiuns erinnerte. Doch trotz seiner Behinderung war er unglaublich schnell. Er warf sich von einer Seite auf die andere; sein Lauf erinnerte an ein schlingerndes Schiff. Aus dem schiefen Mund mit den aufgequollenen Lippen troff Speichel. Vor dem Bauch baumelte ein Kästchen, das von einem Lederriemen um den Hals gehalten wurde. Unzählige Amulette baumelten von seiner fadenscheinigen Kleidung; sie klingelten wie ein Wald kleiner Glocken. Andreas trat beiseite, um dem seltsamen Genossen aus dem Weg zu gehen. Der Mann beachtete ihn nicht, sondern rannte mit seltsam grunzenden Lauten hinter der Sau her.
Als Andreas den beiden nachsah, kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er zog die Stiefel aus dem Schlamm, raffte seinen Priesterrock und eilte dem Mann nach.
Er entsprach Elisabeths Beschreibung von Johannes Dulcken. Der Schlamm spritzte unter Andreas’ Schuhen hoch, während er quer über den Neumarkt hastete. Einige Viehhändler sahen ihn verständnislos an; er benahm sich nicht gerade wie ein Stellvertreter Gottes auf Erden. Der Verfolgte humpelte zwischen Kühen und Pferden hindurch, die scheuten und sich wiehernd aufbäumten; die Entfernung zu seiner Beute wurde indes immer größer. Als er schon beinahe an der alten Mauer war, rief Andreas ihm nach: »Johannes Dulcken! Bleibt stehen! Ich muss mit Euch reden!«
Die Gestalt drehte sich im Laufen um, rutschte auf einem Kothaufen aus, ruderte mit den Armen, verlor das Gleichgewicht und stürzte fluchend. Das Kästchen sprang auf, und Gewürze, Steine und Kräuter verteilten sich über das schmutzige Pflaster. Rasch raffte der Mann seine Habseligkeiten zusammen. Das Schwein entkam indes quiekend hinter einen Pferch und war nicht mehr zu sehen. Nach ein paar Schritten war Andreas bei dem Gestürzten und reichte ihm die Hand.
Читать дальше