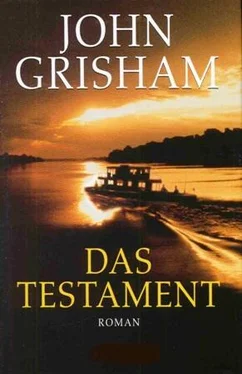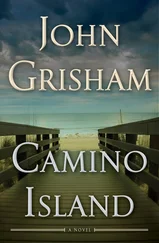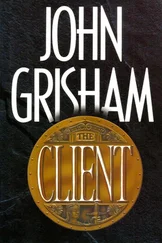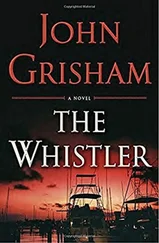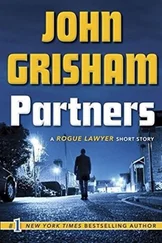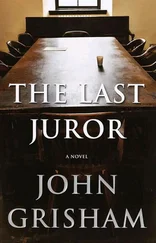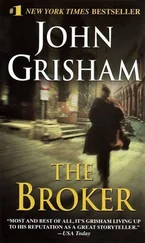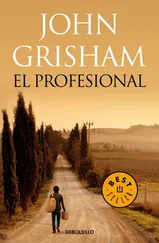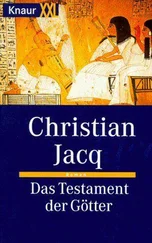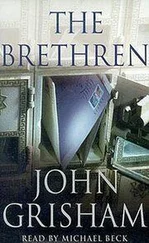» Auf der Santa Loura?«
»Ja.«
»Wo ist Jevy?« . .
»Im Pantanal.«
»Und das Boot?«
»Das ist untergegangen.«
Der Anwalt merkte, wie müde und verängstigt der Junge war. »Setz dich«, sagte er, und die Sekretärin lief, um Wasser zu holen. »Erzähl alles der Reihe nach.«
Welly umklammerte die Armlehnen des Sessels, auf dem er saß, und sprach schnell. »Jevy und Mr. O'Riley sind mit dem Beiboot aufgebrochen, um die Indianer zu suchen.«
»Wann war das?«
»Weiß ich nicht genau. Vor ein paar Tagen. Ich sollte auf der Santa Loura bleiben. Ein Unwetter, das schlimmste, das ich je erlebt habe, hat das Boot mitten in der Nacht vom Ufer losgerissen und zum Kentern gebracht. Ich bin ins Wasser gefallen. Ein Viehtransportboot hat mich später rausgefischt.«
»Wann bist du hier angekommen?«
»Erst vor einer halben Stunde.«
Die Sekretärin brachte ein Glas Wasser. Welly dankte ihr und bat um Kaffee. Auf den Schreibtisch der Sekretärin gestützt, betrachtete der Anwalt den armen Jungen. Er war schmutzig und roch nach Kuhmist.
»Das Boot ist also verloren?« fragte Valdir.
»Ja. Tut mir leid. Ich konnte nichts machen. Ich habe so ein Unwetter noch nie erlebt.«
»Und wo war Jevy bei dem Unwetter?«
»Irgendwo auf dem Cabixa. Ich mache mir Sorgen um ihn.«
Senhor Ruiz ging in sein Büro, schloss die Tür und trat erneut ans Fenster. Mr. Stafford war fünftausend Kilometer entfernt. Jevy konnte in einem kleinen Boot überleben. Es gab keinen Anlass, übereilte Schlüsse zu ziehen.
Er beschloss, erst einmal einige Tage nichts zu unternehmen. Gewiss würde Jevy bis dahin nach Corumba zurückkehren.
Der Indianer stand im Boot und hielt sich an Nates Schulter fest. Der Motor lief nicht erkennbar besser als vorher. Er stotterte, hatte Aussetzer und brachte bei Vollgas weniger als die Hälfte der anfänglichen Leistung zustande.
Sie fuhren an der ersten Indianeransiedlung vorüber. Der Fluss schlängelte sich in einer Weise, dass man annehmen konnte, er drehe sich im Kreise. Dann gabelte er sich, und ihr Begleiter wies ihnen die Richtung. Zwanzig Minuten später sahen sie ihr kleines Zelt. Sie legten dort an, wo Jevy zuvor sein Bad genommen hatte, brachen das Zelt ab und begaben sich mit ihrer Habe ins Dorf. Dort wollte der Häuptling sie haben.
Rachel war noch nicht zurück.
Weil sie nicht zum Stamm gehörte, lebte sie nicht in einer der Hütten um den Dorfplatz, sondern etwa dreißig Meter entfernt allein, näher am Waldrand. Ihre Hütte wirkte kleiner als die übrigen, und als sich Jevy nach dem Grund dafür erkundigte, erklärte der Indianer, den man ihnen zugeteilt hatte, schließlich lebe sie allein. Während sie zu dritt - Nate, Jevy und ihr Indianer - unter einem Baum am Rande des Dorfes auf Rachel warteten, sahen sie dem täglichen Treiben zu.
Der Indianer hatte von den Coopers, dem Missionars-Ehepaar, das vor Rachel da gewesen war, Portugiesisch gelernt. Außerdem kannte er eine Handvoll englischer Wörter, die er ab und zu an Nate ausprobierte. Vor den Coopers hatten die Ipicas noch nie einen Weißen gesehen. Mrs. Cooper war an Malaria gestorben, und Mr. Cooper war dorthin zurückgekehrt, woher er gekommen war.
Die Männer seien beim Fischfang und auf der Jagd, erklärte er den Gästen, und die Jüngeren hätten sich zweifellos zu ihren Freundinnen geschlichen. Den Frauen oblag die schwere Arbeit - Kochen, Backen, Waschen und die Aufsicht über die Kinder. Aber was auch immer es war, jede Tätigkeit wurde gemächlich erledigt. Bereits südlich des Äquators verging die Zeit langsamer als im Norden, aber den Ipicas war der Begriff Zeit völlig fremd.
Die Türen der Hütten blieben offen, und die Kinder rannten aus einer in die andere. Junge Mädchen flochten sich im Schatten gegenseitig Zöpfe, während ihre Mütter am Feuer arbeiteten.
Das Äußere der Hütten sah sauber und gepflegt aus. Gemeinsam benutzte Flächen wurden mit Strohbesen gekehrt. Ganz allgemein schienen die Ipicas großen Wert auf Sauberkeit zu legen. Frauen und Kinder badeten dreimal täglich im Fluss; die Männer zweimal, und nie mit den Frauen zusammen. Zwar waren alle nackt, aber es gab durchaus private Bereiche.
Am Spätnachmittag versammelten sich die Männer vor dem Männerhaus, dem größeren der beiden rechteckigen Gebäude in der Mitte des Platzes. Nachdem sie sich eine Weile mit ihren Haaren beschäftigt hatten, sie schnitten und reinigten, begannen sie zu ringen. Dabei stellten sie sich Mann gegen Mann und Fuß gegen Fuß. Das Ziel der Übung bestand darin, den Gegner zu Boden zu werfen. Zwar ging es bei diesem Zeitvertreib rauh zu, aber er folgte strengen Regeln, und zum Schluss lächelten die beiden Kontrahenten einander fröhlich an. Für den Fall, dass es zu Streitigkeiten kam, griff der Häuptling schlichtend ein. Die Frauen sahen mit flüchtigem Interesse aus den Türen der Hütten zu, als erwarte man das von ihnen. Kleine Jungen ahmten ihre Väter nach.
Nate saß auf einem Baumstumpf und beobachtete dies Schauspiel, das aus einem anderen Zeitalter stammte. Er fragte sich, wohin er da eigentlich geraten war, und es war nicht das erste Mal, dass er sich diese Frage stellte.
Nur wenige der Indianer um Nate herum wussten, dass das kleine Mädchen Ayesh hieß. Schließlich war sie nur ein Kind und lebte in einem anderen Dorf. Doch alle wussten, dass eine Schlange ein Mädchen gebissen hatte.
Sie unterhielten sich den ganzen Tag lang darüber und achteten darauf, dass ihre eigenen Kinder in der Nähe blieben.
Beim Abendessen kam die Mitteilung, dass das Mädchen tot war. Ein Bote kam gerannt und brachte dem Häuptling die Nachricht, die sich binnen Minuten in allen Hütten verbreitete. Mütter zogen ihre Kinder noch näher an sich.
Nach einer Weile sah man Rachel auf dem Hauptweg mit Lako und den beiden Männern, die sie den ganzen Tag lang begleitet hatten. Als sie das Dorf betrat, hörten alle auf zu essen und zu reden und sahen zu dem kleinen Trupp hin. Während Rachel an den Hütten vorüberging, senkten die Leute die Köpfe. Sie lächelte einigen zu, sprach leise mit anderen, blieb stehen, um dem Häuptling etwas zu sagen, und ging dann zu ihrer Hütte. Ihr folgte Lako, der stärker hinkte als am Vormittag.
Sie kam in der Nähe des Baumes vorüber, unter dem Nate mit Jevy und dem Indianer den größten Teil des Nachmittags zugebracht hatten, schien sie aber nicht wahrzunehmen. Jedenfalls sah sie nicht zu ihnen hin. Sie war müde und schien darauf bedacht, in ihre Hütte zurückzukehren.
»Und was tun wir jetzt?« fragte Nate. Jevy gab die Frage auf portugiesisch weiter.
»Wir warten«, kam die Antwort.
»Was für eine Überraschung.«
Lako stieß zu ihnen, als die Sonne hinter den Bergen unterging. Jevy und der Indianer gingen ins Dorf, um zu essen, was vom Abendessen übriggeblieben war. Nate folgte dem Jungen zu Rachels Hütte. Sie hatte sich bereits umgezogen, stand mit nassen Haaren im Eingang und trocknete sich das Gesicht mit einem Handtuch ab.
»Guten Abend, Mr. O'Riley«, sagte sie mit ihrer leisen, langsamen Sprechweise.
»Hallo, Rachel. Bitte nennen Sie mich doch Nate.«
»Setzen Sie sich da drüben hin, Nate«, sagte sie und wies auf einen niedrigen Baumstumpf, der dem, auf dem er die letzten sechs Stunden verbracht hatte, bemerkenswert ähnlich sah. Er stand vor der Hütte in der Nähe eines Steinrings, in dem sie vermutlich ihr Kochfeuer entzündete. Er setzte sich. Sein Hinterteil war immer noch gefühllos.
»Das mit dem kleinen Mädchen tut mir leid«, sagte Nate.
»Sie ist bei ihrem Herrn.«
»Aber nicht ihre armen Eltern.«
»Nein. Sie sind tief bekümmert. Es ist sehr traurig.«
Die Arme um die Knie geschlungen, den Blick verloren in die Ferne gerichtet, saß sie im Eingang ihrer Hütte.
Читать дальше