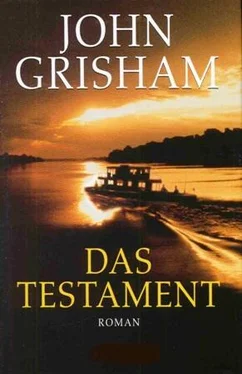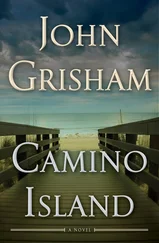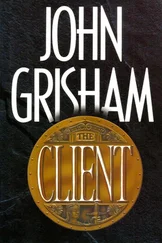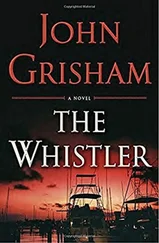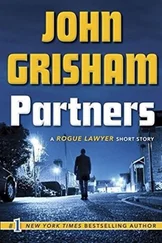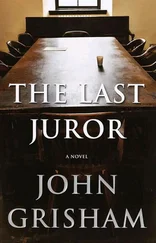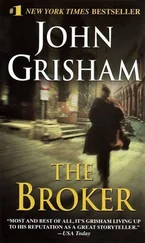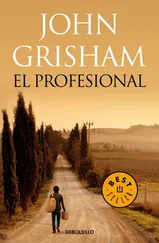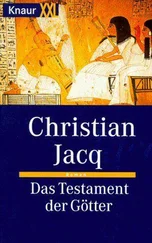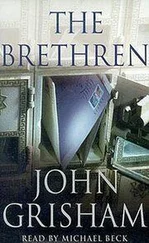Morgen für Morgen, ohne Ausnahme. Gegen Ende seines letzten Zusammenbruchs hatte er wochenlang keinen Vormittag bei klarem Bewusstsein erlebt. Aus lauter Verzweiflung hatte er eine Beratungsstelle aufgesucht und die Frage, ob er sich erinnern könne, wann er zum letzten Mal einen ganzen Tag nüchtern geblieben war, mit Nein beantworten müssen.
Er vermisste das Trinken, nicht aber die Folgen.
Welly zog das Beiboot auf die Backbordseite der Santa Loura und vertäute es. Sie waren gerade dabei, es zu beladen, als Nate herunterkam. Das Abenteuer trat in eine neue Phase ein. Nate war für einen Szenenwechsel bereit.
Der Himmel war bedeckt. Es sah nach Regen aus. Als die Sonne schließlich durchbrach, war es sechs Uhr. Nate wusste das, weil er seine Armbanduhr wieder angelegt hatte.
Ein Hahn krähte. Sie hatten den Bug ihres Bootes nahe einem kleinen Bauernhof an einem Balken vertäut, der einst einen Anleger getragen hatte. Links, im Westen, mündete ein sehr viel kleinerer Fluss in den Paraguay.
Die Aufgabe bestand darin, das Beiboot nicht zu überladen. Die kleineren Nebenflüsse, zu denen sie wollten, waren überschwemmt, und die Ufer ließen sich nicht immer erkennen. Falls das Boot zu tief im Wasser lag, konnten sie auf Grund laufen oder, schlimmer noch, die Schraube des Außenbordmotors beschädigen. Einen Ersatzmotor gab es nicht, lediglich ein Paar Paddel, die Nate von Deck aus betrachtete, während er seinen Kaffee trank. Sie würden sicherlich ihren Dienst tun, überlegte er, vor allem, wenn wilde Indianer oder hungrige Tiere sie verfolgten.
Drei Kanister mit je zwanzig Litern Kraftstoff standen fein säuberlich in der Mitte des Bootes. »Das müsste für fünfzehn Betriebsstunden reichen«, erklärte Jevy.
»Das ist eine ganze Menge.« : »Ich gehe gern auf Nummer Sicher.« »Wie weit ist es bis zu der Ansiedlung?« »Das weiß ich nicht genau.« Er wies zu dem H*US hinüber. »Der Bauer da drin hat gesagt, vier Stunden. «
»Kennt er die Indianer?«
»Nein. Er mag sie nicht. Er sagt, am Fluss hat er noch keine gesehen. «
Jevy lud ein kleines Zelt und ein Regenüberdach dafür ins Boot, zwei Wolldecken, zwei Moskitonetze, zwei Eimer, um Wasser aus dem Boot zu schöpfen, und sein Regencape. Welly fügte eine Kiste mit Lebensmitteln und einen Kasten mit Wasserflaschen hinzu. Nate hatte sich auf seine Koje in der Kajüte gesetzt. Er entnahm seiner Aktentasche die Kopie des Testaments samt dem Formblatt für die Empfangsbestätigung und die Ver-
zichterklärung, die sie unterschreiben musste, falls sie das Erbe ausschlagen wollte, faltete alles säuberlich und steckte es in einen Briefumschlag mit dem Aufdruck der Kanzlei Stafford. Da es an Bord weder wasserfeste Dokumentenhüllen aus Kunststoff noch Müllsäcke gab, wickelte er den Umschlag in ein quadratisches Stück Plastik von fünfundzwanzig Zentimetern Kantenlänge, das er aus dem unteren Ende seines Regencapes geschnitten hatte. Er verschloss das Päckchen mit Klebeband, bis er es für wasserdicht hielt. Dann klebte er es sich mit Pflaster vor der Brust auf das T-Shirt und zog ein Jeanshemd darüber.
Die Tasche mit den Kopien der Dokumente gedachte er auf der Santa Loura zu lassen. Da sie ihm weit sicherer erschien als das kleine Beiboot, beschloss er, auch das Satellitentelefon dort zu lassen. Er kontrollierte noch einmal Papiere und Telefon, verschloss die Aktentasche und legte sie auf seine Koje. Heute könnte es klappen, dachte er bei sich. Die Vorstellung, Rachel Lane endlich kennenzulernen, erfüllte ihn mit einem Gefühl erregender Vorfreude.
Zum Frühstück verzehrte er rasch ein Brötchen mit Butter. Er stand oberhalb des Beiboots an Deck und betrachtete die Wolken. Er wusste, wenn in Brasilien jemand »vier Stunden« sagte, bedeutete das sechs oder acht Stunden, und so brannte er darauf, dass sie endlich abfuhren. Als letztes lud Jevy eine glänzende Machete mit langem Griff ins Beiboot. »Für die Anakondas«, sagte er lachend. Nate bemühte sich, das zu überhören. Er winkte Welly zum Abschied und wandte sich seiner letzten Tasse Kaffee zu. Dann legten sie ab, und Jevy warf den Außenbordmotor an.
Es war kühl, und Dunst hing dicht über dem Wasser. Seit Corumba hatte Nate den Fluss aus der Sicherheit des Oberdecks betrachtet; jetzt saß er praktisch auf dem Wasser. Er sah sich um, konnte aber keine Rettungswesten entdecken. Das Wasser klatschte gegen den Aluminiumrumpf. Aufmerksam hielt Nate im Dunst Ausschau nach Treibgut: ein zersplitterter Baumstamm, und das kleine Boot wäre hin.
Sie mussten kräftig gegen die Strömung ankämpfen, bis sie die Einmündung des Nebenflusses erreichten, der sie zu den Indianern bringen würde. Dort war das Wasser weit ruhiger. Beim Aufjaulen des Motors erzeugte die Schraube des Bootes ein schäumendes Kielwasser. Rasch blieb der Paraguay hinter ihnen zurück.
Auf Jevys Karte war das Gewässer als Cabixa eingezeichnet. Jevy hatte diesen Fluss noch nie befahren, weil es dazu keinen Anlass gegeben hatte. Er wand sich wie ein abgewickeltes Stück Schnur zwischen Brasilien und Bolivien hin und her, ohne erkennbar irgendwo zu enden. War er an seiner Mündung in den Paraguay höchstenfalls vierundzwanzig Meter breit gewesen, verengte er sich im Laufe der Zeit noch weiter auf etwa fünfzehn Meter. An manchen Stellen war er über die Ufer getreten, an anderen wuchs das Unterholz an den Rändern dichter als am Paraguay.
Nach einer Viertelstunde sah Nate auf die Uhr. Er hatte sich vorgenommen, genau auf die Zeit zu achten. Jevy nahm Fahrt weg, als sie sich der ersten Gabelung näherten; zahllose weitere würden folgen. Ein Fluss von gleicher Breite ging nach links ab, und Jevy stand vor der Entscheidung, welcher Richtung sie folgen mussten, um auf dem Cabixa zu bleiben. Sie hielten sich rechts, fuhren jetzt aber langsamer und gelangten bald auf eine große Wasserfläche, die wie ein See aussah. Jevy stellte den Motor ab. »Augenblick«, sagte er, stellte sich auf die Treibstoffkanister und sah auf das Wasser um sie herum. Das Boot lag vollkommen still. Dann fiel ihm eine Reihe gezackter niedriger Bäume auf. Er wies in die Richtung und sagte etwas.
Nate wusste nicht, wie sicher Jevy seiner Sache war. Er hatte die Flusskarten gründlich studiert und sich lange auf diesen Gewässern aufgehalten. Sie alle führten zum Paraguay zurück. Falls er eine falsche Richtung einschlug und sich verirrte, würde die Strömung sie schließlich zu Welly zurückbringen.
Sie fuhren an der Linie der niedrigen Bäume und überschwemmten Dickichte vorüber, die während der Trockenzeit das Ufer bildete, und befanden sich bald in der Mitte einer seichten Wasserfläche, über der sich ein Baumdach wölbte. In Nates Augen sah das nicht wie der Cabixa aus, aber ein rascher Blick zu Jevy zeigte nichts als Zuversicht.
Nach einer Stunde erreichten sie die erste menschliche Ansiedlung - eine kleine Hütte mit einem roten Ziegeldach. Das Wasser stand an den schlammbedeckten Mauern fast einen Meter hoch, und man sah nicht den geringsten Hinweis auf Mensch oder Tier. Jevy nahm Fahrt weg, damit sie miteinander reden konnten.
»In der Regenzeit gehen viele Menschen im Pantanal mit ihren Kühen und Kindern in höhergelegenes Gelände.
Da bleiben sie dann drei Monate.«
»Ich habe hier aber nichts gesehen, was höher liegt.«
»Viel gibt es davon auch nicht. Aber jeder pantaneiro kennt eine Stelle, die er um diese Jahreszeit aufsuchen kann.«
»Und was ist mit den Indianern?«
»Die ziehen auch umher.«
»Ist ja großartig! Wir wissen nicht, wo sie sich aufhalten, und sie ziehen gern umher.«
Leise vor sich hin lachend, sagte Jevy: »Wir finden sie schon.«
Sie trieben an der Hütte vorüber, die weder Türen noch Fenster hatte. Besonders einladend sah sie nicht aus. Neunzig Minuten. Nate hatte seine Furcht, gefressen zu werden, schon ganz vergessen, doch dann sahen sie nach einer Flusskrümmung einen Trupp Kaimane, die dicht beieinander im nur etwa eine Handbreit tiefen Wasser ruhten. Die Ankunft des Bootes störte sie auf. Schwanzschlagend suchten sie tieferes Wasser auf. Nate warf einen Blick auf die Machete, für alle Fälle, und lachte dann über seine eigene Dummheit.
Читать дальше