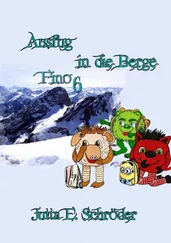Troll drehte sich zu mir um. Sie riss die Augen auf. »Wie siehst du denn aus?«
Woher sollte ich das wissen, ich konnte mich ja nicht sehen. Wenn ich allerdings nur halb so schlecht aussah, wie ich mich fühlte, konnte ich Trolls Entsetzen verstehen.
Troll legte mir ihre eiskalte Hand auf die Stirn. »Himmel, du glühst ja.«
Ich nickte.
»Wir blasen die Aktion ab. Komm wir hauen ab.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, wir ziehen die Sache durch. Koste es, was es wolle.«
Ich fand mich mit meiner schleppenden Aussprache nicht gerade überzeugend, aber Troll lenkte ein.
»Na gut«, sagte sie. »Da vorne muss es sein.«
Wie durch ein Wunder fanden wir P23. Der Abschnitt war ungefähr zweihundert Meter lang. Wir trennten uns, begannen an den beiden entgegengesetzten Enden und arbeiteten uns Waggon für Waggon aufeinander zu. Ich war die Glückliche, die ihn fand.
Der Mann lag noch genau so da, wie ich ihn Freitagnacht in den Waggon gelegt hatte. Ich rief Troll, die mit unsicheren Schritten über den rutschigen, unebenen Boden herbeieilte. Sie warf einen Blick auf das Kleiderbündel und holte hörbar Luft.
»Das ist also Rüdigers Papa.«
Ich nickte.
»Und du hast den Typ allein in deinen Kofferraum geladen und in diesen Zug gesteckt?«
»Hm.«
Ihr Blick, mit dem sie mich von der Seite musterte, war eindeutig bewundernd.
Wir nickten uns in schweigendem Einverständnis zu. Wir mussten zu Ende bringen, wofür wir hierhergekommen waren. Gemeinsam zogen wir an dem Fuß, der uns am nächsten war. In dem Moment, als der Körper sich bewegte, flitzten zwei kleine, schwarze Schatten quiekend los, einer davon über meinen Arm. Troll schlug reaktionsschnell danach und das quiekende Pelztier flog in hohem Bogen gegen die Waggonwand. Wir blickten uns entsetzt an.
»Geh einen Schritt zurück«, sagte Troll.
Kurz und heftig zog sie den Körper am Fuß in eine günstigere Position zu uns her. Diesmal flitzte nichts.
Entschlossen packten wir die Arme und Beine und schleppten das unhandliche Paket ein paar Meter weit, wo wir es schnaufend wieder ablegten. Letzten Endes zerrten wir den Mann im Rettungsgriff rückwärts weiter, die abgelaufenen Hacken der Schuhe zogen dabei Rillen in den Schnee. Völlig nass geschwitzt kamen wir mit unserer Fracht nach über einer halben Stunde am Auto an.
An die Rückfahrt habe ich keine Erinnerung, vermutlich habe ich wieder die ganze Zeit geschlafen. An der Düsseldorfer Stadtgrenze weckte Troll mich.
»Wohin jetzt mit ihm?«, fragte sie.
Ich nannte ihr Lauensteins Adresse. Troll fuhr vor und klingelte, aber niemand öffnete. Ich beglückwünschte mich zu meiner Geistesgegenwart, neben meinen privaten Schlüsseln auch die meiner Kunden eingesteckt zu haben, und schloss das Tor auf. Troll fuhr den Wagen vor die Tür des Kühlraums, mit vereinten Kräften luden wir das Diebesgut ab, sie knallte die Heckklappe zu und fuhr den Wagen wieder auf die Straße. Ich stand einen Moment unschlüssig herum. Sollten wir ihn einfach hier draußen liegen lassen? Ich war so fertig, dass ich mich kaum noch rühren konnte und Troll hatte mit dem Thema offensichtlich abgeschlossen, denn sie saß im Auto und hupte ungeduldig. Ich zuckte mit den Schultern, schloss das Tor ab und schleppte mich mit letzter Kraft auf den Beifahrersitz. Troll brachte mich nach Hause.
Sie schloss meine Wohnungstür auf, bugsierte mich ins Schlafzimmer und fing an, mich auszuziehen. Die ganze Zeit murmelte sie beruhigend vor sich hin, aber erst, als sie sich selbst auszog und mit unter meine Bettdecke schlüpfte, verstand ich, was sie sagte: »Wer braucht schon Männer. Das haben wir zwei Hübschen doch ganz toll allein hinbekommen.« Dann küsste sie mich auf den Mund.
Meine Reaktion war reflexhaft. Ich stieß sie so heftig von mir, dass sie aus dem Bett fiel. Sie rappelte sich hoch, starrte mich mit Tränen in den Augen an, sammelte ihre Kleider zusammen und stürmte aus der Wohnung.
Die folgenden zwanzig Stunden verschlief ich. Lauenstein versuchte in der Zeit neun Mal, mich anzurufen, aber ich hörte noch nicht einmal das Klingeln. Wirklich wach wurde ich erst, als Lisbeth sich mit einem besorgten Gesichtsausdruck über mich beugte und einen sehr unheiligen Fluch ausstieß. Wie durch Nebelschleier bekam ich mit, dass sie jemanden anrief, mich in eine Decke wickelte und auf dem Sofa parkte, während sie das Bett neu bezog, nebenbei Tee kochte und mir schlückchenweise Hustensaft einflößte. Dann kam ein Mann, der mich gegen meinen Willen und trotz heftiger Gegenwehr aus meiner Decke wickelte und mir einen eiskalten Gegenstand auf den Rücken presste, der sich als Stethoskop entpuppte. Die Aufforderung, tief zu atmen, konnte er sich sparen, denn ich schnappte nach Luft, sobald das kalte Metall meine Haut berührte, und begann dann zu husten, dass dem armen Herrn Doktor mit den Stöpseln im Ohr vermutlich die Trommelfelle flatterten. Er diskutierte aufgeregt mit Lisbeth, wobei mehrfach das Wort Krankenhaus fiel, aber ich hörte gar nicht richtig zu. Mir war alles egal. Lisbeth verschwand, kam kurz darauf wieder und zwang mich, eine riesengroße Tablette zu schlucken. Dann ging sie ins Büro, wo ich sie telefonieren hörte. Den Rest des Tages und die folgende Nacht verschlief ich wieder.
Zwischen meinen Tiefschlaf- oder Wachphasen träumte ich wirres Zeug von Leichen, die in meiner Wohnung herumlagen, ich träumte von Lauenstein und von Greg, wobei mal der eine und mal der andere tot war. In einem anderen Traum stand ich an einem offenen Grab, vor dem Lauenstein auf dem Boden hockte und mich um Verzeihung bat. Die Träume verstörten mich zutiefst und ich fürchtete, dass ich einen ernsthaften, bleibenden Schaden davongetragen hatte.
Erst allmählich tauchte meine Oma in den Träumen auf und half mir, mit all den Toten fertig zu werden. Und mit Troll, denn sie stand immer irgendwo am Bildrand herum und starrte mich mit vorwurfsvollen Blicken an.
Zwei weitere Tage vergingen, während derer Lisbeth mich morgens und abends besuchte, mir Suppe und Tee und Antibiotika eintrichterte und gelegentlich mit Kunden telefonierte. Donnerstagabend scheuchte sie mich aus dem Bett, damit ich gemeinsam mit ihr am Tisch zu Abend aß. Es fiel mir schwer.
»Was hast du eigentlich mit diesem Lauenstein?«, fragte Lisbeth.
Mein Hustenanfall war nicht gespielt. Nach einer Weile war ich in der Lage zu fragen: »Wie kommst du darauf, dass ich überhaupt was mit Lauenstein habe?«.
Lisbeth sah mich spöttisch an. »Kind, mir kannst du nichts weismachen. Er hat am Sonntagabend und im Verlauf des Montags neun Mal versucht, dich zu erreichen. Das sieht nicht danach aus, als wolle er lediglich über Putzaufträge mit dir sprechen.«
Ich zuckte mit den Schultern, hielt die Augen starr auf meine Suppe geheftet und schwieg.
»Als ich am Montag bei ihm war, hatte er extra auf mich gewartet und fragte, wie es dir ginge. Er machte sich Sorgen, weil er dich nicht erreichen konnte und wusste, dass du letzte Woche krank warst.«
Wie rührend. Allerdings wäre es noch rührender gewesen, wenn er mich nicht allein nach Belgien hätte fahren lassen.
»Höflicher Mensch«, murmelte ich, während ich weiter Nudelsternchen zählte.
»Corinna Leyendecker«, ermahnte Lisbeth mich mit schneidender Stimme. »Du verheimlichst mir etwas.«
Das stimmte, und das würde auch so bleiben. Es macht schließlich keinen Sinn, jemandem zu sagen, was man ihm verheimlicht, denn dann ist es ja nicht mehr geheim. Ich hatte nicht den Hauch von Lust, Lisbeth die ganze Geschichte zu erzählen. Obwohl Lisbeth sicher nicht zur Hysterie neigte und vermutlich zu Gesetz und Totenruhe ein angemessen entspanntes Verhältnis pflegte, wollte ich ihr diese Räuberpistole nicht zumuten. Und mir auch nicht mehr. Ich wollte diese ganze Sache nur noch vergessen und Lauenstein nie wiedersehen.
Читать дальше