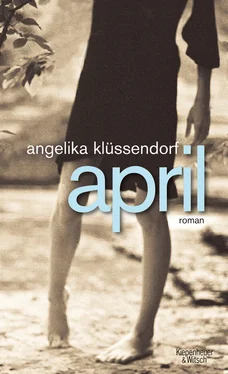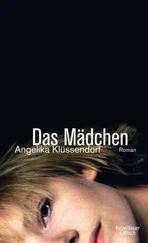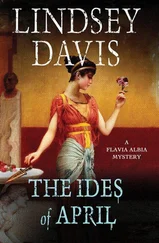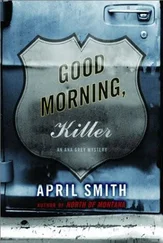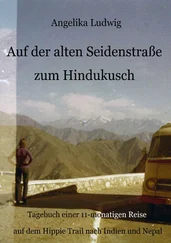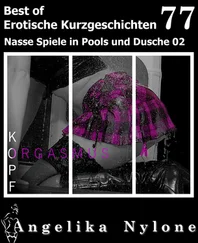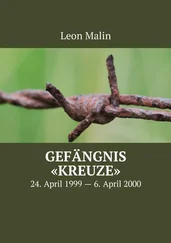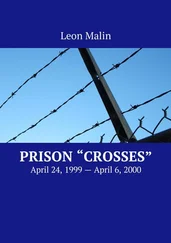Die Station besteht aus großen Schlafsälen mit je zwölf Betten, Frauen und Männer sind durch einen Flur und eine doppelt gesicherte Tür voneinander getrennt. Der Speiseraum wird auch für die Gruppentherapien genutzt, aus einem Untersuchungszimmer hört sie manchmal Schreie. Einige Patienten, die sich zitternd an ihre Zigaretten klammern, offenbar ihre letzte Verbindung zur Welt, erinnern April an Gespenster.
Ab und an setzt sie sich zu der weißhaarigen Frau auf das Bett und liest ihr aus dem» Sommernachtstraum «vor. Andere alte Frauen setzen sich dazu, reden dazwischen, stellen Fragen.
Das sind nur orientierungslose Langzeitpatienten, erklärt ihr eine junge, hübsche Pflegerin, als stünden diese Frauen in der Hierarchie ganz unten. April fragt sich, warum die Pflegerin hier arbeitet, wenn sie so abfällig über die Kranken redet.
April kann die alten Frauen zu einem Spaziergang überreden. Sie folgen ihr über das Klinikgelände, setzen vorsichtig einen Fuß vor den anderen, als würde ein falscher Schritt sie in die Irre führen. Es ist einer der ersten Herbsttage, an dem das Licht sein verführerisches Spiel mit den Farben treibt. April scherzt mit den Frauen, als wären sie Kinder, zeigt ihnen Tiere am Himmel, einen Schneehasen, eine Giraffe, sie möchte, dass ein Lebensfunke auf sie überspringt. Vor einem Obstgarten fordert sie die Frauen auf, Schmiere zu stehen, und klettert über den Zaun. Ihr müsst mich warnen, wenn wer kommt, ruft sie ihnen zu, und allmählich tauen die Frauen auf, nehmen die gestohlenen Äpfel mit Verschwörerblick entgegen.
Warum bist du hier, fragt eine hagere Frau.
Gute Frage, sagt April und zuckt mit den Achseln.
Die Hagere lässt nicht locker: Wo sind deine Eltern?
Ich bin meine eigene Mutter und mein eigener Vater, sagt sie und hört selbst den Trotz in ihrer Stimme.
Jetzt wird April von allen Frauen umringt. Die Hagere streicht ihr übers Haar. Ach Kindchen, sagt sie, fühlst du dich denn nicht allein?
Ihr kommen die Tränen, und sie hat keine Lust, ihr Gegenüber zu zerlegen, also heult sie los.
Weinen ist gut, sagt eine Frau, deren Haare nach Perücke aussehen.
Wenn du nicht weinen willst, musst du an was Böses denken, dann hört es auf, sagt die Hagere.
April muss lächeln und fragt sich, wie viele Menschen sonst noch die gleichen Tricks anwenden.
Du hast schöne blaue Augen, sagt die Perückenfrau, ich hatte mal einen Kater mit solchen Augen.
Und ihr, warum seid ihr hier, fragt April.
Die Hagere erzählt, dass in ihrem Rücken ein Krebsgeschwür wächst. Wir wurden zum Sterben hierher abgeschoben, sagt sie, weil es sonst keinen Platz für uns gibt. Doch wir sind zäh, sagt eine andere, und ihr Lachen ähnelt einem Schluckauf.
In den nächsten Tagen und Wochen unternimmt April weitere Ausflüge mit den alten Frauen, die manchmal schon morgens vor der Tür auf sie warten. Sie mag ihre Gesichter, besonders das der weißhaarigen Frau, die das Bett nicht verlassen darf. Stundenlang liest sie ihr vor oder lauscht ihrem Gesang, dunkel und vibrierend. April kann von den Liedern über Liebe und Tod nicht genug bekommen, und in den Pausen erzählt ihr die Frau von längst vergangenen Triumphen auf der Bühne; die Pagode auf ihrem Nachtschränkchen ist das Geschenk eines berühmten Dirigenten.
Wenn ich die Augen schließe, sagt sie, höre ich noch immer den Beifall, du musst wissen, ich hatte einen schönen, starken Körper. Hier fühl mal, sagt sie, nimmt Aprils Hand, führt sie an ihre Kehle, das war früher ein perfekter Resonanzraum, und jetzt wuchert darin die reine Hässlichkeit.
Die alte Sängerin erzählt ihr, dass sie Kehlkopfkrebs und im besten Fall noch ein halbes Jahr vor sich hat. Kannst du dir vorstellen, fragt sie, dass ich einmal jung war und die hübschesten Füße hatte?
Ja, das kann April sich durchaus vorstellen.
Wenn sie abends ihr Zimmer betritt, möchte sie am liebsten wieder umkehren. Die Einsamkeit nimmt den ganzen Raum ein, wie eine zweite Person, die April den Sauerstoff wegatmet.
Schlaflos streunt sie durch die Innenstadt, geht in Bars, in Kneipen, schlägt sich durch lärmendes Gelächter und erscheint früh mit schwerem Kopf in der Klinik. Sie verschweigt ihrem Arzt die nächtlichen Ausflüge. Es reizt sie, ihm mit wirren Argumenten zu widersprechen, als wolle sie ihrer Rolle als Patientin in einer Klapsmühle gerecht werden. Noch nie hat sie so viel Aufmerksamkeit erfahren, und doch begegnet sie dem Arzt mit Abwehr und Misstrauen. Sie fragt sich, ob sein Interesse ihr gilt oder der Arbeit.
Erich Honecker schaut im taubenblauen Anzug ungerührt von den Klinikwänden. Als Patient würde er wahrscheinlich gar nicht auffallen. Den Kranken ist ihre Krankheit kaum anzusehen — es gibt den Stotterer, der nur auf Zehenspitzen läuft, einige Frauen haben wegen der Tabletten Schnurrbärte bekommen, aber bei keinem springt einem die Verrücktheit ins Gesicht. April fühlt sich hier auf eine seltsame Weise wohl, das Essen schmeckt ihr, sie empfindet eine gewisse Zuneigung für die anderen Patienten, beinahe wie für Wesensverwandte.
In der Töpfergruppe fällt ihr ein junger Mann auf, unter dessen großen Händen wundersame, filigrane Figuren entstehen. Er bearbeitet das Material hoch konzentriert, doch sobald die Therapiestunde beendet ist, wirft er sein Kunstwerk an die Wand. April kommt mit ihm ins Gespräch. Nichts ist so, wie es scheint, sagt er aufgeregt und beginnt fachmännisch von seiner Krankheit zu reden. Er sei hin und her geworfen zwischen Manie und Depression, im Moment befinde er sich in einer manischen Phase. Der junge Mann heißt David und hatte ein Semester Malerei studiert, bevor es anfing: Die Farbe Rot kam wie ein Gewitter über ihn. Das Rot schluckte alle anderen Farben, und natürlich war das ein Zeichen des Aufbruchs, aber sein Professor wollte das nicht einsehen.
Seitdem ist Rot sein dominierender Zustand, obwohl die Farbe gerade etwas schwächelt, und doch wird er ihr nie mehr entkommen können. Auch April stellt sich Gefühle und Dinge in Farben vor: Freude ist für sie orange, Ekel braunviolett, Andalusien eindeutig erdfarben. Der Name David könnte durchaus etwas Rötliches an sich haben.
David muss in der Klinik übernachten. Doch es scheint den anderen egal zu sein, wenn sie gemeinsam tagsüber die Therapiestunden schwänzen. Sie ziehen durch die Stadt, er zeigt ihr seinen Lieblingsfriedhof, sie suchen auf den Grabsteinen nach ausgefallenen Namen, erfinden ein Leben dazu, überbieten sich gegenseitig mit faszinierenden Details. Bei einem Streifzug zeigt sie David ihre alte Schule, das Mietshaus, in dem sie die frühen Kinderjahre verbracht hat, dann führt sie ihm ihre Mutter vor. Im Eingangsbereich der» Mitropa «stehen sie hinter einem schweren Vorhang, April deutet auf eine der Kellnerinnen: Das ist sie. Sie versucht, ihre Mutter mit seinen Augen zu sehen, ein breiter, runder Rücken, Arme und Hände, die schwer beladene Tabletts durch die Gegend wuchten, eine sich müde arbeitende Frau mit schiefem Lächeln. Es strengt sie an, ihre Mutter zu betrachten. April sieht Hände, die kräftig zuschlagen können, sie sieht ein freudloses Gesicht und darüber wie festgezurrt die blonde Perücke. Kurz befürchtet sie, ihre Mutter könnte gleich vor ihren Augen explodieren, in lauter scharfkantige Splitter zerspringen.
Du siehst ganz anders aus, sagt David.
Sie haben sich ein kleines Ritual ausgedacht: Während sie in Aprils Zimmer frühstücken, reden sie sich in der dritten Person an. Danke und bitte, Eure Majestät, sagen sie und reichen sich den Salzstreuer. David könnte sogar als König durchgehen, groß und kräftig hockt er im Schneidersitz auf dem Boden, sein lockiges Haar wird von einem Stirnband gehalten, statt eines Zobels schmückt ihn eine Kette aus Biberzähnen. Sie hören» Summertime «und immer wieder» Lay Lady Lay «von Bob Dylan; die LP hat David mitgebracht. Sie trinken schon vormittags Wein, beobachten die Spatzen vor dem Fenster, diskutieren über Religion, suchen ihre eigene Weltformel.
Читать дальше