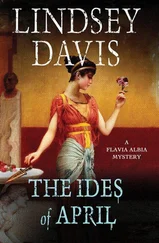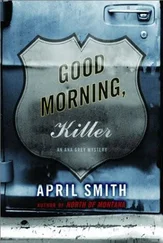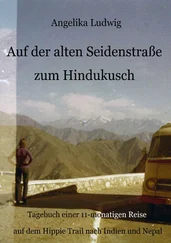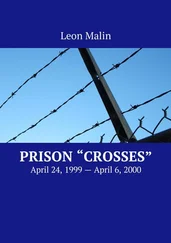Trotz ihrer Verliebtheit versucht sie, Michael distanziert zu betrachten. Er ist nicht nur Maler, er schreibt auch, eins seiner Gedichte wäre beinahe veröffentlicht worden. Das Gedicht handelt von einem Asteroiden, der im Gegensatz zum Meteoriten gleich die ganze Erde plattmachen könnte, Michael legt großen Wert darauf, dass sie das eine nicht mit dem anderen verwechselt. Sie versucht, sich ihre Skepsis nicht anmerken zu lassen, überlegt insgeheim, ob er es selbst ernst meint. Und dann der abrupte Wechsel zwischen seiner zwanghaften Munterkeit und elender Verzagtheit: Er werde ohnehin bald sterben, sein Herz sei viel zu klein für diese hundertsechzig Pfund Fleisch, Knochen und Gedärme.
Wenn sie mit Michael durch die Straßen geht, gelten die Blicke der Frauen alle ihm, während er nur Augen für April hat. Die ersten grauen Haare lassen ihn noch verwegener aussehen, doch was sie wirklich an ihn bindet, ist die alte Unsicherheit: Meint er es gut mit ihr oder eher nicht?
April steht früh am Bahnsteig und wartet auf die S-Bahn. Der Frühling, die Sonne, Vögel bauen ihre Nester zwischen die stählernen Balken, und doch ist etwas anders als sonst. Sie sieht sich um, Menschen mit müden Gesichtern, Frauen geschminkt, ungeschminkt, quengelnde Kinder, Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin. Ein Obdachloser, zerlumpt, barfuß, wippt auf seinen Sohlen, neben ihm sein Hab und Gut in Tüten. April läuft den Bahnsteig entlang, fängt den Blick eines Anzugträgers auf, ein winziges Lächeln hebt seine Mundwinkel, aber er schaut an ihr vorbei, scheint einen bestimmten Punkt zu fixieren. Sie dreht sich um, da ist nur der Obdachlose, der ungläubig seine Füße betrachtet, als hätte er bisher Flossen an den Beinen gehabt. Auf dem Bahnsteig ist es stiller als sonst. Oder kommt es ihr nur so vor? Eine Taube pickt mit ihrem Schnabel auf den Boden, es klingt, als würde sie etwas morsen. Der Obdachlose atmet hörbar aus, murmelt vor sich hin. Erst als er sich setzt, aufsteht, sich wieder setzt, begreift April, was anders ist: Dort, wo bis zum gestrigen Tag noch eine Bank stand, auf der man sich zum Schlafen ausstrecken konnte, befindet sich eine Reihe von abgeteilten Sitzgelegenheiten. Allen Umstehenden dürfte klar sein, warum die Bank neu gestaltet wurde: Niemand soll darauf schlafen. Nun können sie sich hier nicht mehr breitmachen, sagt eine Frau laut in die Runde. Alle verstehen, dass sie die Obdachlosen meint, niemand widerspricht. Und April? Auf welcher Seite steht sie? In den nächsten Tagen fällt ihr auf, dass die alten Bänke an allen öffentlichen Plätzen ausgetauscht wurden.
April traut ihrem Mitleid genauso wenig wie ihren anderen Gefühlen. Wenn sie einem Bettler Geld gibt, kommt sie sich ganz und gar unecht vor, als würde sie Theater spielen. Manchmal verspürt sie sogar die Regung, das Geld des Bettlers zu stehlen und davonzulaufen.
Als sie die Frau mit der Schleife im Haar das erste Mal wahrnimmt, hat sie das Bedürfnis, ihr zu helfen — und sie will ihr eigenes Mitleid erkunden. Die Frau, in einen Wintermantel gehüllt, sitzt am Stamm einer großen Kastanie, die Hand zum Betteln aufgehalten. Sie wird angesehen, teils mitleidig, teils angeekelt, die Leute werfen ihr Geldstücke aus sicherer Entfernung zu, niemand will ihre ausgestreckte Hand berühren. Die Frau verströmt einen unangenehmen Geruch, der Dreck haftet schichtweise an ihr, wie eine zweite Haut. Warum trägt sie diesen warmen Mantel, fragt sich April, es sind bereits sommerliche Temperaturen. Im verfilzten Haar der Frau steckt eine gelbe Geschenkschleife. Wenn sie sich bedankt, entblößt sie mit einem Clownslächeln ihre dunkel gefärbten Zähne, April hat den Eindruck, dass in diesem Lächeln leiser Spott liegt. Sie legt ihr die Geldstücke immer in die Hand. Einmal reicht sie ihr einen Apfel, die Frau beißt hinein, verzieht den Mund und wirft den Apfel in hohem Bogen auf die Straße. April würde gern mit ihr ins Gespräch kommen, würde gern erfahren, wie sie früher gelebt hat, würde ihr gern Anerkennung aussprechen für ihr jetziges Leben, ein Außenseiterleben, doch die Frau lächelt nur träge, wenn sie ihr zunickt. April möchte der Frau mehr geben als nur Geld, sie möchte ihr etwas geben, das sie eine wirkliche Anstrengung kostet. Sie lädt die Frau ein, bei ihr zu Hause zu baden. Zu ihrer Überraschung erhebt sich die Frau sofort, als hätte sie nur auf eine solche Einladung gewartet, sie sammelt eilig ihre Tüten ein und bleibt vor ihr stehen. Gut, gehen wir, sagt April und sieht erst jetzt, wie groß die Frau ist, eine kompakte Riesin. Den Wintermantel über die Schultern geworfen, ähnelt sie einer Gewichtheberin, die schnaufend mit kleinen Schritten voranschreitet. Hier geht es lang, sagt April und deutet auf die Kreuzung, wortlos folgt ihr die Frau, die Schultern etwas nach vorn geschoben, und von einer Sekunde zur anderen möchte April unsichtbar sein. Hat sie etwa damit gerechnet, dass ihre Einladung ausgeschlagen wird? Die Frau kichert plötzlich, als könnte sie ihre Gedanken lesen, doch bei genauerem Hinhören ist das Kichern ein Hustenanfall. April bleibt vor ihrem Haus stehen und hält der Frau die Tür auf. Im Treppenhaus ist es still, am liebsten würde sie die Sache rückgängig machen, was hat sie sich nur dabei gedacht? Warum ist sie nicht ins Kino gegangen und hat sich einen rührseligen Film angesehen? Während April ihre Wohnungstür öffnet, hält sie die Luft an, die Riesin folgt ihr so selbstverständlich, als wäre sie hier zu Hause. Die Tüten können Sie hier abstellen, sagt April und deutet auf eine Ecke im Flur. Die Frau wischt sich über die Stirn und sieht sie wortlos an, ihre Augen leuchten wie Glas.
So, sagt April, ich lass erst mal das Badewasser ein. Sie bleibt so lange im Bad, bis die Wanne voll ist, legt einen großen Stapel frische Handtücher bereit.
Auf dem Flur hat die Riesin sich nicht von der Stelle gerührt. Das Bad ist fertig, sagt April. Die Frau zuckt die Schultern, lacht tonlos auf. Sie wertet es als Zustimmung: Ich habe Badeschaum reingemacht, riecht nach Zitrone. Die Frau folgt ihr ins Bad, April lässt sie allein in dem dampfenden Raum, bleibt eine Weile hinter der geschlossenen Tür. Dann setzt sie sich an den Küchentisch, spürt Wärme vom Boden her aufsteigen. Leise äfft sie sich selbst nach: Riecht nach Zitrone. Sie schließt die Augen, überwältigt von Schwäche und Ekel, Ekel nicht vor der Frau, sondern vor sich, ihrer Anmaßung, es geht doch immer nur um sie — die Frau nichts weiter als Mittel zum Zweck, und alles ihrem kindischen Wollen untergeordnet, ohne jedes Maß. Sie hört aus dem Bad ein Grunzen und Husten und denkt an die Schweinerei später, eine besudelte Wanne, der Boden völlig verdreckt. Ein Geräusch lässt sie aufhorchen: Möge die Wohnungstür tatsächlich ins Schloss gefallen sein. Sie geht ins Bad, die Frau ist weg, auch die Tüten im Flur sind verschwunden. Sie spürt Erleichterung, Dankbarkeit, aber auch den Hauch einer Kränkung. In der Badewanne, auf dem hochgetürmten Schaum, ein gelber Fleck, April nimmt die Schleife mit spitzen Fingern und wirft sie in den Abfall. Dann lässt sie das Badewasser ab, doch nach einer Weile steckt sie den Stöpsel wieder ein, zieht sich aus und steigt in die Wanne.
Zunächst meidet April die Stelle um den großen Kastanienbaum. Später, sie hat den Vorfall beinah vergessen, läuft sie doch wieder daran vorbei, aber die Frau sitzt nicht mehr da. April sieht sie nie wieder.
Michael hat sie zu einer Reise nach Sizilien eingeladen. Am Tag vor ihrem Abflug liegt im Briefkasten die Antwort auf ihre Stipendiumsbewerbung. Sie steckt den Brief ungeöffnet ein, verabschiedet sich von Julius, der kaum sein tobendes Spiel mit Saskia unterbricht, Marie erteilt ihr noch Ratschläge, immerhin hat sie in Syrakus geheiratet. Julius wird während ihrer Reise bei seinem Vater wohnen, und sie ist froh, dass Hans nicht in eine andere Stadt gezogen ist.
Читать дальше