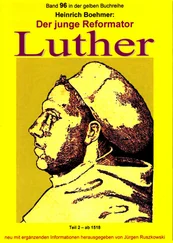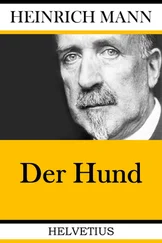Aber noch bevor ich dergleichen von mir geben konnte, hatte Simon nach meiner Hand gegriffen. Er hatte seine Skibrille hochgezogen und schaute mich mit seinen schwarzen, großen Augen an, deren lange Wimpern eine Allee bildeten, Wimpern, von denen manche Frauen in Stuttgart meinten, es sei eine Gemeinheit, daß dieser Junge sie besitze, wo er sie doch gar nicht nötig habe. Erst jetzt fiel mir ein, wie sehr Simons lange Augenhaare zu denen eines Straußenvogels paßten. Aber das war in diesem Moment nicht der Punkt. Sondern wie sehr der Junge bemüht war, mir die Angst zu nehmen. Sein Lächeln umklammerte meine Sorge.
Keine Frage, er war bereit, mich an der Hand über den Steg zu führen, der freilich nicht nur ohne Geländer war, sondern auch recht schmal. Seite an Seite wäre es zu eng gewesen.
«Geh du vor«, bat ich Simon.
Er verstand mich, marschierte los. Ich in seinem Schatten. In der Mitte aber blieb ich plötzlich stehen. Und zwar nicht aus Panik — obgleich ich durchaus eine solche verspürte — , sondern um dieser Panik eins auszuwischen. Denn sowenig ich den Anblick des Abgrunds ertrug, zog ich ausgerechnet jetzt das iPad aus dem Rucksack, hielt es mir erneut vors Gesicht, öffnete das Fotoprogramm und tippte auf das Symbol des Auslösers. Dabei meinte ich, meine Beine nicht mehr zu spüren. Nicht nur einfach taub, sondern aufgelöst, verschwunden. Mein Rumpf schwebte. Aber er schwebte etwas unruhig, schaukelte im Wind. Gleichzeitig empfand ich eine Begeisterung ob meiner Handlung. Ich fiel nicht um und auch nicht in Ohnmacht, sondern packte das iPad wieder ein und beendete den Gang. Gewissermaßen das kurze Stück auch ohne Beine überwindend.
Nachdem wir alle die Brücke passiert hatten, fragte mich Kerstin:»Was war das denn grad?«
«Der Triumph des Willens.«
«Du weißt aber schon, daß das der Titel von einem Nazifilm ist.«
Stimmt. Doch daran hatte ich nicht gedacht und sagte einfach:»Jetzt ist es halt mein Titel.«
Im Grunde war das auch ein schöner Ausspruch. Wie sehr das Wollen imstande war, die eigene Schwäche auszuhebeln (ironischerweise war es bei den Nationalsozialisten eigentlich umgekehrt gewesen). Aber Kerstin ließ mich nicht gewähren. Sie fragte:»Ist dir eigentlich klar, daß oberhalb von der Hütte ein Bergwerk ist, das die Nazis betrieben haben? Mit Zwangsarbeitern.«
«Wie bitte?«Ich hatte nicht die geringste Ahnung.»Was für ein Bergwerk denn, um Himmels willen?«
«Du heute mit deinem Willen!«Sie wunderte sich über mich. Daß ich nichts gelesen hatte über den Berg, auf dem meine Schwester gestorben war. Den Berg und was hier alles geschehen war.
«Ich weiß, wie hoch er ist«, sagte ich, aber nicht einmal das stimmte wirklich.
Kerstin klärte mich auf. Dort, wo der Astri-Berg im südlichen Kammverlauf auf seinen Nachbarberg traf, lag eine Scharte, unterhalb derer die Nazis ein Stollensystem zur Gewinnung von Molybdän errichtet hatten.
«Molyb… was?«
«Molybdän. Man hat das zur Härtung von Stahl benötigt. — Panzerrohre!«erläuterte Kerstin und fügte an, daß neben der Berghütte, zu der wir uns gerade bewegten, noch das erste Lager der Zwangsarbeiter zu erkennen sei.
Ich fragte mich, ob man eigentlich irgendeinen Flecken in diesen Ländern Österreich und Deutschland finden konnte, der nicht auf diese Naziweise vergiftet war. Von der Geschichte verdreckt, hier um so mehr, als über das Schicksal der Menschen, die man in der alpinen Höhe verschlissen hatte, nichts bekannt war. So berichtete wenigstens die belesene Kerstin, die auch viel besser wußte, in welcher Position wir uns gerade befanden, wo im Norden, wo in den Zillertaler Alpen und in welcher Entfernung zu Hütte und Gipfel und Bergwerk. Kerstin hatte einen Kompaß in ihrem Kopf.
Doch so prächtig, wie das Wetter war, brauchten wir einfach nur dem markierten Weg zu folgen.
«Klaaf-quaol!«rief Simon und zeigte mit dem Arm nach oben.
Jetzt sah ich sie, die Flagge in der Ferne, Flecken von Blut, die im Wind wehten, wahrscheinlich das Rot-Weiß-Rot der Österreicher. Was sonst? Die Flagge und dann die Hütte, ein vor über hundert Jahren vom Alpenverein in die Landschaft gepflanztes steinernes Haus, welches — wie Kerstin erzählte — interessanterweise lange Zeit der Sektion Gera (Gera in Thüringen) gehört hatte, jedoch nach dem Krieg — nicht ganz unpassend — von den Russen den Österreichern zugesprochen wurde, um freilich später wieder an die Deutschen, diesmal an die bayerischen Landshuter, zurückgegeben zu werden. Die Berge und das Rot-Weiß-Rot waren aber österreichisch geblieben.
Jedenfalls war es eine schöne Hütte, die wir nun schweißnaß erreichten, viel Holz und Stein, kompakt, auf eine hübsche Weise wetterfest, ein Haus, das seinen eigenen Schwierigkeitsgrad bewältigt hatte, ohne verhärtet anzumuten, dazu eine Terrasse, von der man einen herrlichen Weitblick besaß, während im Rücken die aufschießende Gestalt des Astri-Bergs den Himmel deutlich verkleinerte, so nah war man jetzt an dem Brocken aus Granit.
«Auf Astri«, sagte Kerstin, als feierten wir ihren Geburtstag.
«Auf Astri!«rief ich und nickte mit dem Kopf.
Simon tat es mir gleich und sprach ein Wort, das sich anhörte, als würde ein kleiner Helikopter aus seinem Mund schlüpfen und den Berg hochkreiseln.
Wir wurden von der Hüttenwirtin herzlich begrüßt und in unser vorbestelltes Vierbettzimmer geführt, einen vollständig in Naturholz eingekleideten Raum, der mir das Gefühl gab, mich in einem der Schlafzimmer der allbekannten sieben Zwerge zu befinden (und tatsächlich existierten auch Matratzenlager für sieben Personen). Wir deponierten das Gepäck und beeilten uns, hinaus auf die Terrasse zu gelangen und unseren Durst zu löschen. Die Wirtin setzte sich zu uns an den Tisch und wollte wissen, welche Pläne wir hätten. Ihr Tirolerisch war in keiner Weise geheim: Deutsch als Gebirgsbach, gurgelnd, aber verständlich.
Ich vermied es, von Astri zu sprechen, die vor ihrem Tod ja ebenfalls auf dieser Hütte gewesen war. Statt dessen erkundigte ich mich nach dem Weg zum ehemaligen Bergwerk.
«Das sind hin und zurück noch mal drei Stunden«, erklärte die Hausherrin und verwies auf die Geröllhalden, die man zu queren hatte.
«Gefährlich?«fragte ich.
«Anstrengend«, antwortete sie und empfahl uns, auf den nächsten Tag zu warten. Immerhin seien fünfhundert Höhenmeter zu bewältigen. Ihr Mann würde morgen eine kleine Gruppe von Wanderern zum Bergwerk führen. Wenn wir wollten, könnten wir uns anschließen. Und den Jungen hierlassen.
Was ich ganz sicher nicht tun würde. Eher war zu überlegen, ob man sich das Bergwerk sparen solle. Aber es reizte mich schon, mir das anzusehen. Einen Stollen in derartiger Höhe, eine dieser Nazimaßlosigkeiten. Wobei mir die Wirtin erzählte, es sei zwar bis zum Ende des Krieges gegraben worden, man hätte aber nie auch nur ein Gramm Molybdän erzeugt. Die Planer waren von viel zu optimistischen Annahmen ausgegangen, den Berg als ein verpacktes Geschenk begreifend, bei dem man sich einen bestimmten Inhalt wünschte. Aber so ist das oft mit den Geschenken. Einmal ausgepackt, ist es schlimmer, als hätte man gar nichts bekommen.
Jedenfalls entwickelte sich das Ganze zum Desaster. Es war der übliche» Triumph der Blödheit«. Obgleich bereits im zweiundvierziger Jahr das Wirtschaftsministerium die Sinnlosigkeit des Unterfangens erkannte, und später dann, 1944, auch das Rüstungsministerium, hörte man trotzdem nicht auf, wohl aus der» Logik «heraus, schon einmal damit angefangen und bereits eine Menge Geld investiert zu haben. Und so investierte man weiter, ohne jemals einen Nutzen zu erhalten. (Klar, das war bei den Nazis gewesen. Solche Dinge geschahen heute nicht mehr.)
Читать дальше