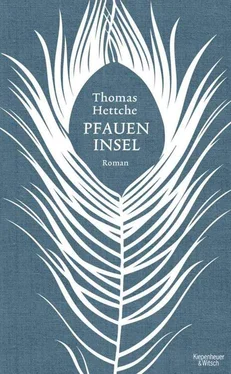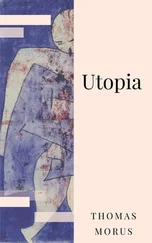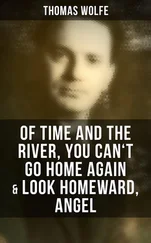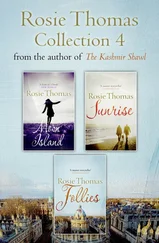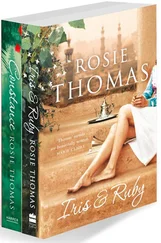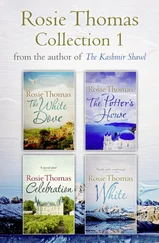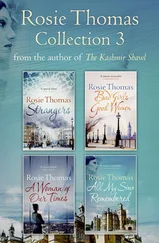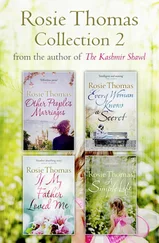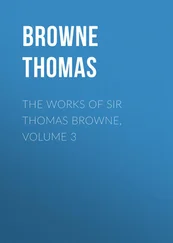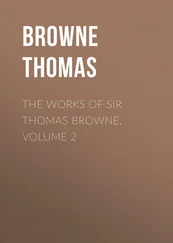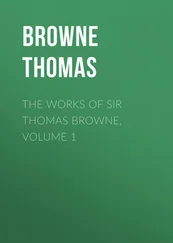Er musterte Marie, offenbar besorgt von ihrem Zittern und den Tränen, und wollte wissen, was sei. Doch sie wiegelte ab. Das Alter.
»Sie heißen Max?«
»Maximilian. So hat der Onkel mich getauft.«
Marie nickte. »Gehen Sie schon«, ermunterte sie ihn und zwang sich zu einem Lächeln.
Dann war sie allein. Doch es dauerte nur einen Moment, und die Pfauen kamen wieder heran, und wie in einem sehr langsamen Tanz begannen sie Marie zu umkreisen, scheinbar ohne sie zu beachten. Müde setzte sie sich auf die grüne Bank, auf der sie früher manchmal mit Gustav gesessen hatte, und sah ihnen zu. Und erinnerte sich, als Kind einmal gebannt beobachtet zu haben, wie die Tiere im Frühling umeinander warben. Wie tröstlich es ihr erschienen war, daß die wunderschönen Männchen vor den doch so unscheinbaren Weibchen balzten. Bald war es wieder soweit, sehr langsam und zärtlich würden sie die Mäntel ihrer Federn über sich und ihre Hennen senken.
Es gibt Tiere, die erinnern uns daran, wie unsere Träume entstanden. Staunend stehen wir immer wieder vor ihnen, als wäre es das erste Mal, daß wir sie sehen, und sehen zugleich all die Bilder, die wir uns von ihnen gemacht haben. Und sie? Sie schreiten vor uns auf und ab und lassen sich betrachten, schreiten auf und ab an der Grenze von Leben und Bild, für uns. So schlägt, jedesmal von neuem, ein Pfau sein Rad in all dieser prunkenden Großartigkeit. Das Blau, das Grün, der goldene Glanz. Das zitternde Krönchen auf seinem hocherhobenen Kopf mit den großen blicklosen schwarzen Augen. Der Hals wie mit winzigen glänzenden Schuppen belegt, gerüstet in ein Kettenhemd aus Glanz. Dieser schmale gotische Vogelritter in Minne, hinter sich reckend und präsentierend sein Wappenschild der Schönheit, diese wippende orientalische Helmzier der reinen Symmetrie, augenbestickt und wimpernselig wie die vielaugigen Flügel der Seraphim, knisternd in der Bewegung wie Seide, ein Baldachin aus Schönheit, der uns mit jenem Köpfchen gleich mitzubedecken verspricht, ein Schutzschirm, fragil wie ein Prunkzelt, ein Paravent, der sich triumphierend in unseren Blick schiebt, alles verdeckt, alles ausschließt, alles vergessen macht. Und doch nichts ist als eine hauchdünne Membran aus Farbe und Glanz.
Und wie die Sonne da hineinstürzt und wieder heraus! Uns in die Augen aus seinen Augen. Und immer bewegt sich da etwas im Flattern dieser unendlich vielen Augen, immerzu flüstert es im Federgezitter. Ein Prospekt voll Farbengelächter, das plappert und wispert, horizontweit aufgespannt, trägt dieses Tier mit sich herum und wendet es immer uns zu, mit allem darauf, was uns gefällt. Stumm und leer aber bleibt der Blick des Vogel selbst dabei, als gingen ihn all die Fragen gar nichts an, die seine Schönheit anscheinend so beharrlich uns stellt.
Wie seltsam, daß all der Prunk Lennés, den der König befohlen hatte in seinem unbedingten Willen, die Zeit seines Vaters vergessen zu machen, wieder getilgt worden war von der Insel, tot und verdorrt, und nichts geblieben war als der Glanz der Pfauen. Nichts außer ihr, die immer noch da war. Und die Kulissen einer lange vergangenen Zeit, die niemals von sich behauptet hätte, eine bessere Natur erschaffen zu wollen, sondern die einfach nur Freude hatte an Zöpfen, Muscheln und Rocaillen und allem, was ungewöhnlich war. Denn der Schöpfer hatte es gemacht, und seine Phantasie war grenzenlos. Was sollte sie jetzt nur tun? Ein Satz fiel Marie ein, den sie im Werther gelesen hatte: Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles.
Marie blinzelte in die Sonne. Die Pfauen waren weitergezogen, ohne daß sie es bemerkt hatte. Man schaut immer entweder mit oder gegen das Licht, hatte der Onkel sie gelehrt. Mit dem Licht wirken Formen flach, gegen das Licht aber gewinnen sie Kontur und Tiefe. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, erkannte sie in den Zügen jenes Mannes nichts wieder. Für alles war es einmal zu spät. Marie spürte, daß die Luft ihre Tränen getrocknet hatte. Wieder einmal hatte die Insel für sie entschieden. Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles. Da hilft es nichts wiederzubekommen, was man so sehr vermißt hat. Ruhig wartete sie auf ihre Besucher und genoß die Zeit in der Sonne. Als die beiden den Sandweg wieder entlangkamen, konnte Marie schon von weitem sehen, wie Nietner auf seine Frau einsprach, mit großer Begeisterung, und dabei mit weit ausholenden Gesten um sich zeigte.
»Und nun freue ich mich, endlich zu sehen, wovon der Onkel stets mit allergrößtem Enthusiasmus erzählt hat: das berühmte Palmenhaus«, erklärte er, als die beiden wieder vor ihr standen und Ananthi sich gleich neben Marie auf die Bank setzte.
»Wie schlicht und schön ist dieser Tempel für die Königin. Er muß sie sehr geliebt haben.«
Das Lächeln der jungen Tamilin wärmte ihr das Herz. So entschied sie, seine Erwartungen nicht vor der Zeit zu enttäuschen, und sagte nichts, während sie weitergingen. Erst, als durch die Bäume des Uferwegs die Glasfront des Palmenhauses sichtbar wurde, begann sie mit ihren Erläuterungen.
»Das Palmenhaus, einhundertzehn Fuß lang, vierzig Fuß tief und zweiundvierzig Fuß hoch, wurde nach dem Entwurfe Schinkels und unter der Leitung Schadows im Jahre 1830 erbaut. Aber das wissen Sie ja sicher, Herr Nietner. Dem Hofgärtner Fintelmann kam es darauf an, schon in der Umgebung des Baus auf das Innere des Hauses vorzubereiten. In größeren und kleineren Gruppen siedelte er hier neben den Götterbäumen noch andere Pflanzen mit ausgezeichneten Blattformen an, die großblättrige Alkermes etwa, den Wunderbaum, Tabak und brasilianisches Mangold.«
Nichts, außer den Götterbäumen, war von diesen Pflanzungen noch zu sehen, und auf den Gesichtern ihrer Besucher zeichnete sich Enttäuschung ab, als Marie auf die kümmerlichen Reste eines Kissenbeetes zeigte, das eher einem überwachsenen Grabhügel glich, und dabei von den üppig geformten Blättern des indischen Blumenrohrs sprach, von Zuckerrohr und Papyrus.
»Nun wollen wir aber hinein!« sagte Nietner, trat unter die Pergola, die den Eingang beschirmte, und griff nach der Tür. Die Überraschung auf seinem Gesicht, als er sie verschlossen fand.
Marie schüttelte den Kopf. »Das geht nicht.«
»Ich verstehe nicht«, sagte er und rüttelte heftig am Türgriff.
»Man kann nicht hinein.«
Er verstehe nicht, sagte er noch einmal. Es sei nicht möglich, wiederholte Marie und lächelte traurig.
Wortlos lief der Ingenieur zurück zu der Glasfront und preßte wie ein kleiner Junge die Stirn gegen das Fenster, um hineinzuspähen. Marie, die ihm mit seiner jungen Frau langsam folgte, sah ihm ungerührt dabei zu.
»Die geschwungene Kuppel mit den spitzbogigen Fenstern, die jetzt das Dach schmückt und die dem ganzen Bau einen exotischen Anschein gibt, wurde erst aufgesetzt, als das allzu große Wachstum der Fächerpalme im Zentrum des Hauses dies nötig machte.«
»Weshalb können wir nicht hinein?« fragte der Ingenieur, sichtlich erregt jetzt.
»Es geht nun einmal nicht.«
Marie wandte sich wieder an die junge Tamilin. »Und glauben Sie mir, Ananthi, es tut mir wirklich besonders leid darum, daß Sie den indischen Pavillon nicht sehen können, der aus Birma hierher zu uns kam, und die Ausmalung im orientalischen Stil, die Sie sicherlich an Ihre Heimat erinnern würde. Aber es ist unmöglich. Und jetzt möchte ich Sie wirklich bitten, mir zu folgen. Es wird Abend, und auch im Schloß gibt es noch einiges zu sehen.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, begann Marie den Uferweg entlangzugehen, der unter den Eichen, die hier dicht standen, zum Schloß führt. Es ist genug, dachte sie, wenn sie sich auch nichts Schmerzhafteres als den Abschied vorstellen konnte, der ihr bevorstand. Sie unterließ es, auf den antiken Brunnen hinzuweisen oder um das Schloß herumzugehen, wo ihre Besucher den Ausblick nach Potsdam gehabt hätten, sondern ging direkt zum Portal, und erst, als sie die Tür öffnete, sah sie sich nach den beiden um, die ihr stumm gefolgt waren und denen sie jetzt den Vortritt ließ in ihr Haus.
Читать дальше