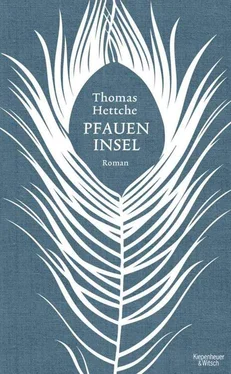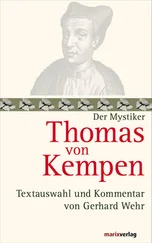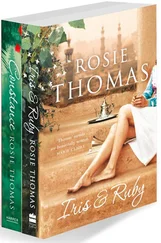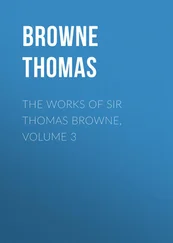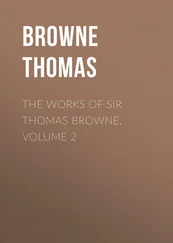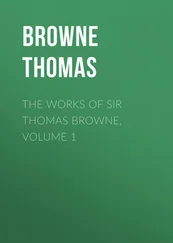»Wie lange leben Sie schon hier, Fräulein Strakon?« fragte die junge Frau.
»Mein ganzes Leben.«
»Das war sicher oft sehr einsam.«
Marie schüttelte den Kopf. »Nein, gar nicht«, sagte sie. »Wir waren ja viele!«
Als sie daraufhin ungläubig angesehen wurde, wechselte Marie das Thema. »Schade, daß Sie die Hortensien jetzt nicht sehen können, deren mehrere als selten so groß gefundene Exemplare es hier noch immer gibt und die sich durch das künstlich erzeugte Blau ihrer naturgemäß roten Blüten auszeichnen. Den vor neun Jahren verstorbenen Hofgärtner Gustav Adolph Fintelmann, der ein halbes Jahrhundert hier auf der Insel gewirkt hat, haben sie weithin berühmt gemacht.«
Gustav. Nun hatte sie den Namen also doch ausgesprochen, den bei ihren Führungen zu nennen sie schlechterdings nicht vermeiden konnte, vor dessen Nennung sie sich aber gleichwohl jedesmal erneut fürchtete.
»Mein Onkel hat mir davon erzählt«, sagte Nietner.
»Verzeihen Sie meine Neugier, Herr Ingenieur, aber es gibt eine hiesige Hofgärtnerfamilie ihres Namens, und es heißt, ein Nietner sei vor langer Zeit nach Ceylon gegangen. Könnte es sein, daß sie verwandt mit jenem Gärtner sind?«
»Das war mein Onkel.«
»Ach.«
Nietner nickte. »Aber ja! Wobei zu sagen, er sei mein Onkel, nicht ganz korrekt ist. Ich bin ein Waisenkind und nicht auf Ceylon geboren, wenn ich auch nichts mehr von der Reise weiß. Meine eigene Erinnerung setzt erst im Haus von Onkel John ein, wie er sich dort unten nennen ließ, denn alles spricht dort ja englisch. Er hat mich an Kindes Statt angenommen.«
Ein Gedanke, den Marie sich im selben Moment verbot, in dem er in ihr entstand, forderte dennoch Platz. Es gilt, nicht jedem Weg ins Dunkel zu folgen, unsere Herzen sind Bergwerke, und wir alle sind Zwerge darin, ängstlich bemüht, das trügerische Glimmen des Katzengolds von jenen Adern zu unterscheiden, die uns nicht sinnlos in die dunkle Nacht hinabbringen. So schnell, wie es ihr möglich war, führte Marie die beiden in den Wald hinein, vorbei an den Gewächshäusern, die Anlaß boten, über die Zucht unter Glas zu sprechen, die man auf der Insel betrieb, und weiter zu jener Stelle, wo der Weg hinab zum Maschinenhaus ging, von dem sie alles Wissenswerte berichtete, und dann weiter zur Fontäne.
»Der Onkel hoffte, ich würde Freude am Gartenhandwerk finden«, erzählte Nietner, während sie hinaufstiegen. »Leider aber war dies nicht der Fall.«
»Nein?«
»Nein.« Das weiche Gesicht, in dem sich alle Gefühle direkt abzubilden schienen, verzog sich bei der Erinnerung.
Marie nickte und setzte sich auf eine der Bänke, die das Becken des Candélabre umstanden. Obwohl ihr die Angst das Herz bis zum Hals schlagen ließ, konnte sie doch nicht anders, als zu fragen, was sie jetzt wissen mußte: »Und wann genau kamen Sie nach Ceylon?«
»1833 war das. Vor fast fünfzig Jahren.«
Vor beinahe fünfzig Jahren, ja. Wie die Hoffnung ihr den Hals zuschnürte! Sie verbarg die zitternden Hände in ihrem Shawl. Alles ist Märchen oder nichts.
»Dabei ist es hier ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Der Onkel hat mir so viel von der Pracht der Gärten in der Heimat erzählt. Und nun ist doch alles«, Nietner suchte zögernd nach dem rechten Wort, »recht herunter, wenn ich ehrlich sein soll.«
Marie mühte sich, ihre Tränen zu bezwingen. Nach einem langen Moment brachte sie schließlich tonlos hervor: »Der dünne Sand nährt kümmerlich einige Gräser, Mauseohr und fette Henne sind die natürlichen Bewohner der Insel. Nur die starken Eichen erreichen mit ihren weithin und tief suchenden Wurzeln einige die Insel durchziehende Lehmadern und saugen dort Feuchtigkeit, wenn im Sommer alles verschmachtet. Alles braucht ständige Pflege, und an der hat es in den letzten Jahrzehnten zunehmend gefehlt. Früher füllte die Dampfmaschine unten im Maschinenhaus dieses Reservoir hier in viereinhalb Stunden. Aus den beiden Schalen des Candélabre stürzte das Wasser in einem romantischen Wassermantel in das große, im Sommer von Vergißmeinnicht umstandene Becken, und ein feiner Wasserschleier wehte schon von Ferne durch das Grün der Eichen.«
Das Becken des Candélabre aber war seit Jahren nicht mehr gesäubert worden, und die Agaven hatte man, als sie vor einigen Jahren bei einem überraschenden Wintereinbruch erfroren, in ihren Kübeln einfach stehengelassen, ihre bleichverdorrten Spitzen hingen starr in alle Richtungen über dem Kies, in dem Löwenzahn wuchs und, an besonders schattigen Stellen und unter den Bänken, dichtes Moos. Traurig führte Marie die beiden den Abhang wieder hinab, dorthin, wo sich einst die Menagerie befunden hatte, obwohl nichts davon mehr vorhanden war, selbst die Grundmauern der Gebäude hatte man beseitigt, nachdem die letzten Tiere abtransportiert worden waren.
Den Boden deckte jetzt dünnes Wintergras, Birken- und Kiefernschößlinge hatten sich ausgesät, Brombeergesträuch wucherte über die letzten Steinhaufen. Aus der nahen Voliere, die als einziges auf der Insel verblieben war, hörte man das Krächzen der letzten Tiere, einige Tauben und Krähen, ein letztes Paar weißer Pfauen.
»Dort kam man früher zum Lamahaus.« Maries Stimme war jetzt dünn und zitternd, und sie mußte sich mit aller Kraft zwingen, lauter zu sprechen, und wandte sich doch dabei von dem Paar ab, dessen Blicke sie in ihrem Rücken spürte.
»Es wurde vom Königlichen Schloßbaumeister Schadow erbaut. Der vordere Hof war für die Lamas bestimmt, die, den Schatten suchend, oft an heißen Tagen im Stall blieben. Auf dem Balkon schaukelten die weithin rufenden Aras, rote, blaue, schwarze. Daneben wanderten mit bedächtigem Schritt die großen neuholländischen Strauße. Der braune flüchtige Guanako, das kolumbische Reh, die westindischen Hirsche, unserem Damwild verwandt, waren auf der anderen Seite untergebracht. Von dort ging man zuerst an den Adlern vorüber, unter ihnen Seeadler in mehreren Exemplaren, dann folgten die Affen, das nordafrikanische Stachelschwein und, im letzten Zwinger der Reihe, der Löwe.«
Nicht einmal mehr zu ahnen war, wo Lenné die Käfige zwischen den Eichen am Rand der großen Schloßwiese gruppiert hatte, die nun beinahe wieder so aussah, wie Marie sie aus ihrer Kindheit kannte. Verschwunden all die hochfahrenden Bilder, stumm wieder die Insel, wie sie es einst gewesen war. Bleich lag das Licht dieses kalten Frühlings auf dem Gras, auf das sie so lange hinstarrte, bis die junge Frau zu ihr kam und, mühsam in dem engen Kleid, vor ihr in die Hocke ging.
»Ein Löwe? Wirklich?«
»Er wurde nicht alt.«
Schüchtern lächelte sie die junge Frau an, die ja für all das nichts konnte. »Und in einem Gehege ganz in der Nähe befanden sich die sonderbaren Känguruhs aus Neuholland.«
»Känguruhs?«
»Ja. Sie machten auf ihren muskulösen Hinterbeinen weite Sprünge. Putzige Tiere. Man hatte ihnen Kaninchen und unsere Hasen beigesellt. Leider hielten auch sie sich stets nur kurze Zeit am Leben.«
»Gehen wir weiter?« fragte die junge Frau des Ingenieurs leise, während sie den Schmerz im Gesicht der Zwergin wohl bemerkte.
Marie nickte. Jenseits der Wiese führte der alte Weg noch, der die Besucher einst von den Känguruhs zur nächsten Attraktion der Insel geleitet hatte, zugewachsen zwischen Büschen und unter Bäumen hindurch zum Cavaliershaus. Mühsam ging sie über das harte Wintergras vorweg.
»Wollen sehen, ob wir bei Rösner etwas zu Mittag bekommen«, murmelte sie halblaut im Gehen mehr zu sich selbst als zu dem Paar, das ihr schweigend durch das kleine Wäldchen folgte.

Kaum standen sie in dem niedrigen Raum, der dem alten Rösner gleichermaßen als Küche und Stube diente, verrußt und zugeräumt mit allerhand Gerätschaften, plazierte er sie auch schon an dem großen blanken Holztisch. Marie war gern hier, das Cavaliershaus damals wie eine Zuflucht für sie gewesen, und sie meinte die Klugin noch zu hören. Kindchen, Kindchen! hatte sie immer zu ihr gesagt.
Читать дальше