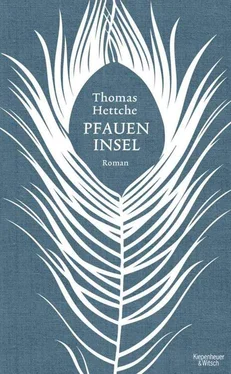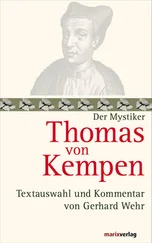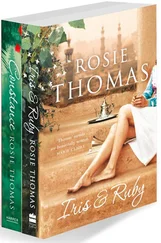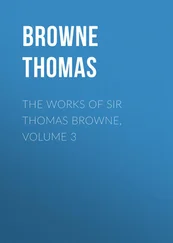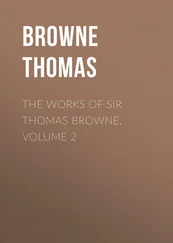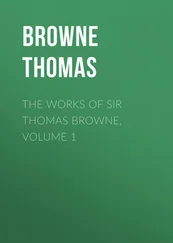Marie begann wortlos zu essen. Niemand, dachte sie, ist mehr da, und sah im selben Moment alle wieder vor sich, und es vergilbten darunter die, die jetzt hier waren, das Schmatzen des vierschrötigen Reuter verschwand klaglos, als Ferdinand Fintelmann seinen Platz wieder einnahm, an die Stelle der beiden Gehülfen setzten sich Gustavs Brüder mit ihren Kindergesichtern, und der alte Rösner verschwand hinter der strengen Gestalt der Tante. Was war nur los, daß die Bilder der Vergangenheit heute so gar nicht verschwinden mochten? Als wäre es die Insel selbst, die ihre Erinnerungen, wie die Blüten einer besonderen Pflanze, die nur hier heimisch war, gerade heute noch einmal hervorbringen wollte. Und da war auch Gustavs Stimme wieder, ganz leise und ganz nah neben ihr, noch ganz die Stimme eines Kindes. In der Geschichte, die Mama mir vorliest, reist der heilige Brandaen bis über den Rand der Welt!
Damit hatte ihr Leben begonnen. Wie hatte er damals ausgesehen? Marie wußte es nicht mehr. Einzig seine Stimme existierte noch von jenem Morgen. Und Christian? Er wird an jenem Morgen neben ihr gesessen haben, doch sie erinnerte sich nicht mehr an ihn, und das tat ihr leid.

»Fräulein Strakon?«
Marie war nicht überrascht, aber es dauerte doch, bis sie sich aus ihren Erinnerungen befreien konnte, dann drehte sie sich um und lächelte ihre Besucher an. Sie wußte, sie hatte noch einen Moment, bis sie mit ihnen sprechen mußte, denn zunächst wurde sie immer gemustert. Seit langem schon fühlte sie sich unter den gierigen Blicken, die sich durch die Jahrzehnte immer gleich geblieben waren, nicht mehr unwohl. Deshalb war sie hier. Wie sie alle deshalb hier gewesen waren, die Tiere ebenso wie die Menschen. Nur, daß der jetzige König irgendwann keine Verwendung mehr für sie gehabt hatte, nicht einmal für sie, die einzig Übriggebliebene in seinem Königreich der Skurrilitäten, das nun sogar ein Kaiserreich war. Alles war anders geworden, lange schon, doch diese Blicke hatten sich nicht verändert, und so stellte sie sich zur Schau.
»Maria Dorothea Strakon, ja«, sagte sie leise.
»Wir haben so viel von Ihnen gehört!«
Ein Ingenieur Nietner und seine junge Frau. Als Reuter ihr den Namen nannte, hatte sie aufgehorcht, denn die Nietners waren eine alte Familie von Hofgärtnern wie die Fintelmanns, seit hundert Jahren dienten sie dem König in verschiedenen Revieren, Marie hatte den Onkel manches Mal von dem alten Nietner sprechen hören, dessen beide Söhne wohl auch gelegentlich hier auf der Insel gewesen waren.
Kurz nach Mittag hatte die Glocke des Fährmanns ihr die Ankunft ihrer Besucher annonciert, und sie war zur Anlegestelle hinuntergegangen, als die beiden im Nebel, der noch immer dicht auf der Havel lag, gerade herübergerudert wurden. Der Ingenieur war ein weicher Mann in einem etwas abgestoßenen Gehpelz und einem fremdartigen Hut, den Marie neben seiner Frau zunächst kaum beachten mochte, so blutjung und schön war sie, fremdartig schön, wobei die Fremdartigkeit vor allem von dem dunkelhäutigen Gesicht der jungen Frau und ihren schwarzen Augen herrührte, zwischen denen, über der Nasenwurzel, ein goldener Punkt prangte. Sie trug einen hochgeschlossenen Mantel, nach der neuesten Mode aus moosgrünem Samt, die schwarzen Haare fielen offen über den Stoff, ein kleines Hütchen darauf.
Am meisten jedoch verwunderten Marie ihre schmalen Hände, die sie, ebenso dunkel wie das Gesicht, zur Begrüßung mit den Handflächen aneinanderlegte, als wollte sie beten, wobei Marie sofort das seltsam verschlungene Muster aus dunkelroter Farbe auf ihnen entdeckte, das sich über die Handrücken zu den Handgelenken und wohl weiter die Arme hinaufspann. Mit unsicherem Lächeln bemerkte die junge Frau Maries Überraschung und sank, weil ihr Mann Marie als Schloßfräulein vorgestellt haben mochte, oder vielleicht auch nur wegen des Größenunterschiedes, in einen Knicks. Solch einen sanftmütigen Blick, mußte sie denken, hatte nur Maitey für sie gehabt. Keinerlei Gier war darin. Sie freue sich ja so sehr, endlich den Ort zu sehen, wo die Königin Luise glücklich gewesen sei, flüsterte die junge Gattin des Ingenieurs Nietner.
Marie war die ungewohnte Nähe nicht angenehm. Und so begann sie, ohne etwas zu erwidern, und die junge Frau so zum Aufstehen bewegend, ihren üblichen Rundgang.
»Die Wohnung des Hofgärtners und Kastellans der Pfaueninsel befindet sich hier unmittelbar an der Anlandestelle. Rechts davon«, deklamierte sie und wies die Anhöhe hinauf, »da, wo ein alter hochberankter Rüsterstamm eine Pumpe verkleidet, führen zwei Wege unter mit Reben bezogenem Bogen einen kleinen Berg hinan.« Während sie gemeinsam hinaufschritten, hörte sie nicht auf zu sprechen. »Es ist gleich, welchen von beiden Wegen man wählt, man kehrt, am Ende der Promenade, zur selben Stelle zurück. Doch muß man dem einmal gewählten Wege unabänderlich folgen, durch nichts etwa zur Seite sichtbar Werdendes sich abziehen lassen, wenn man nicht irgend etwas Interessantes versäumen und auch Umwege vermeiden will.«
Marie verbarg so gut es ging die Anstrengung, die ihr das Gehen bereitete, und ignorierte, wie ihre Gäste sich ihrem langsamen Tempo anzupassen bemühten, von einem Bein aufs andere tretend, wenn sie wieder einen Moment stehenblieb, um Kraft zu schöpfen. Bevor das Schloß auf der Wiese in den Blick kam, wandte Marie sich nach rechts, wo die letzten überlebenden Rosen wuchsen.
»Vielleicht schenken Sie einige Minuten dem Rosengarten hier. Es war der erste in Preußen. Lenné hat ihn 1821 angelegt für die Rosensammlung des Doktor Böhm aus Berlin, die der König in jenem Jahr um fünftausend Taler erwarb, was seinerzeit immerhin ein Zehntel dessen war, was ganz Klein Glienicke gekostet hatte. Es blühte hier vom ersten Mairöschen bis zum ersten Schnee. Leider ist diese Pracht in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr geschrumpft wegen fehlender Mittel zu ihrer Erhaltung. Doch einzelne Stöcke blühen noch immer zu ihrer Zeit. Nur haben Sie keinen recht glücklichen Zeitpunkt für Ihren Besuch gewählt, um dies zu sehen.«
Die beiden Besucher standen ratlos inmitten des nutzlosen Wegenetzes und sahen zu Boden, als suchten sie dort die Spuren der Pracht, von der die Zwergin sprach. Der Ingenieur lächelte verlegen. Die Umstände. Leider sei es ihnen nicht anders möglich gewesen.
Etwas, dachte Marie und musterte ihn, etwas in seinen Augen, etwas in dieser ungewöhnlichen, fast durchsichtigen Bläue war ihr seltsam vertraut. »Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf, Herr Nietner?«
»Aus Ceylon.« Nietner sah lächelnd zu seiner jungen Frau hinüber. »Es ist unsere erste gemeinsame Reise in die alte Heimat.«
Marie erinnerte sich, daß immer wieder Gärtner aus Preußen in die Fremde gegangen waren, ein Fritz Sello, hieß es, sei Pflanzensammler in Brasilien geworden, und ein Johann Nietner habe auf Ceylon eine Stelle gefunden. Beide, das wußte sie, waren niemals zurückgekehrt.
»Und wo liegt dieses Ceylon?«
Der Ingenieur lachte. »Ceylon ist eine Insel südlich von Indien im Ozean. Sie ist heute englisch und kam zum Empire, als man hier in Europa gegen Napoleon focht.«
Der Nebel lichtete sich. Auf dem Gras der Schloßwiese, das zu hoch stand und auf die Mahd wartete, perlte in unendlicher Wiederholung leuchtender Tau. Nietner knöpfte seinen Gehpelz auf und nahm mit den ersten Sonnenstrahlen, die durch den Nebel drangen, seinen Hut ab. Ihm schien trotz der feuchten Kälte warm zu sein.
Überhaupt war er offenkundig nicht von besonders guter Konstitution, dicklich und unbeweglich in der Hüfte, hängend die glattrasierten Wangen, seine Augen aber, klein zwar und fast wimpernlos, doch wasserblau und strahlend, ließen sie nicht los. Etwas an ihnen machte sie unruhig, und sie mußte wieder an den Löwen denken und seinen heißen Atem und verstand nicht, weshalb. Nie weiß man, welchem Anstoß sich welche Erinnerung verdankt, was woran sich bildet, die Träume am Leben oder unser Blick auf die Welt an dem, wovon wir nicht aufhören können zu träumen. Und dennoch! Marie gab sich einen Ruck und setzte ihren Rundgang wortlos fort.
Читать дальше