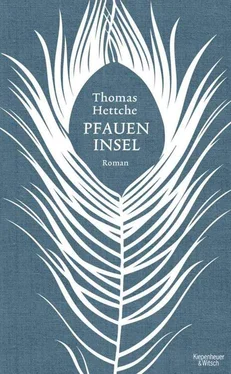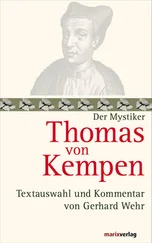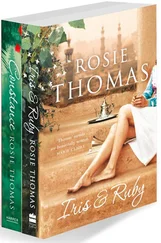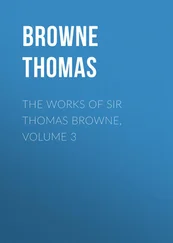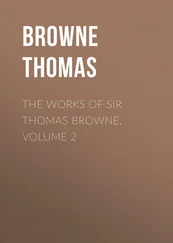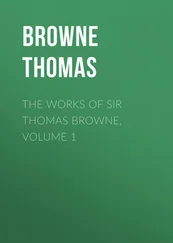Da es Friedrich kurzerhand als eigene Arbeit ausgegeben hatte, belohnte man den Maschinenmeister reichlich und forderte mehr, und er stattete seine Werkstatt mit einem zierlichen Schraubstock aus, winzigen Bohrern, Meißeln, Feilen und Sägen, besorgte auch Stiche der Gebäude, die er Maitey zu fertigen auftrug, und es entstanden, am Hofe hochbegehrt und teuer bezahlt, nach und nach Modelle der schönsten Bauten Preußens, so detailgenau, weil Maiteys Geist nichts mehr wollte, als sich in dieser Arbeit zu verlieren und alles zu vergessen.
Vor allem den Geruch des Todes. Maitey verstand nicht, daß die Menschen den Tod der Tiere nicht rochen, die in ihren Käfigen saßen und nicht vor ihm fliehen konnten. Immerzu wurden sie geleert und neu gefüllt. Wozu? Und selbst die Palmen rochen anders als in seiner Heimat, weil sie es hinter dem Glas des großen Hauses, das alle so bestaunten, kaum ertrugen. Und sie alle, Marie und Christian, der Riese und der Neger, auch sie waren gefangen in unsichtbaren Käfigen, sinnlos wartend auf ihren Tod unter den Blicken der Besucher. Maitey kannte diese Blicke aus dem Haus seines Paten. Es lauerte darin etwas, gierig, als warteten alle, daß er sie mitnähme dorthin, wo er herkam. Und zugleich ließ man ihn nicht weg. Er verstand das nicht. Warum reisten diese Menschen mit großen Schiffen über die Ozeane und holten sich all diese Lebewesen aus der ganzen Welt, um sie sich dann immerzu nur anzusehen? Etwas an uns, dachte Maitey, mögen sie mehr als sich selbst. Aber warum sperren sie uns dann ein? Warum essen sie die Tiere nicht und decken mit den Palmenblättern nicht ihre Häuser?
»Was du da siehst in unseren Blicken, mein lieber Maitey«, hatte der Präsident lachend gesagt, als er ihm einmal zu erklären versucht hatte, was ihn beschäftigte, »ist unsere Romantik.«
Maitey hatte nicht verstanden, was das bedeutete. Er sah Christian in seinem Blut und konnte nicht aufhören zu singen. Und dieses Blut war eine Schuld, von der hier, wie er verzweifelt dachte, niemand wußte, wie sie zu tilgen wäre. Und er hatte Angst davor, was aus ihr hervorgehen würde, und sang immer weiter, bis der Maschinenmeister Friedrich erst rief und dann mit schweren Schlägen seiner Faust gegen die Tür hämmerte, die Werkstatt und Wohnhaus verband, und hörte erst auf, als Friedrich seinen Kopf hereinsteckte und ihn anbrüllte, er solle endlich mit seinem Gejaule aufhören. Schließlich habe es einen Todesfall auf der Insel gegeben, da zieme es sich nicht, unchristliche Lieder zu singen, die zudem keinem zivilisierten Menschen gefielen.

Das Weihnachtsfest 1830 stand bevor. Marie saß starr in ihrem Hochstuhl am Eßtisch. Keinen Bissen des Mittagessens hatte sie angerührt, die Tante ihren Teller wortlos weggenommen, und als alle aufgestanden waren, war sie einfach sitzen geblieben.
Es war ein dämmriger Tag, an dem es nicht richtig hell werden wollte, und Ferdinand Fintelmann, der den Nachmittag in seinem Arbeitszimmer über dem Jahresbericht für die Garten-Intendantur zubrachte, hatte bald den Eindruck, jetzt komme schon wieder die Nacht, zündete eine Lampe an und ging ins Eßzimmer zurück, wo Marie noch immer reglos saß. Die Lampe legte einen warmen Lichtkreis auf das Tischtuch und er allerlei Papiere da hinein, auch Tinte und Feder, dann setzte er sich und fuhr mit seiner Korrespondenz fort. Immer wieder sah er dabei über seine Brille hinweg zu ihr auf, denn er sorgte sich sehr um sie. Fühlte sich zu alt für all das, was geschehen war, und es kam ihm so vor, als entwände ihm die Zeit selbst mit sanftem Griff diesen Ort, der doch einmal sein eigener gewesen war.
Es hatte ihn große Mühe gekostet, bei Hofe dafür zu sorgen, daß das furchtbare Geschehen als ein tragisches Unglück angesehen und nichts gegen seinen Neffen unternommen wurde, und er hatte dabei deutlich gespürt, daß er ein alter Mann war, den man schon nicht mehr ganz ernst nahm. Vor allem die Fürstin Liegnitz, hatte man ihm zugetragen, habe zunächst auf einer Bestrafung bestanden, und Fintelmann mußte selbst nach Berlin reisen und beim König vorstellig werden, um darzulegen, was dies für seine Familie bedeuten würde. Seltsam, aus welchen Gründen der Monarch gezögert hatte, seiner Bitte zu entsprechen. Immer wieder hatte er von der Rücksicht auf Marie, der Schwester des Toten, gesprochen. Sich schließlich aber doch bereit erklärt, das Ganze als Unfall zu den Akten nehmen zu lassen, und in diesem Sinne hielt der Hofgärtner das Geschehene jetzt in seinen Papieren fest. Die Feder kratzte laut in der lastenden Stille, und er fühlte sich schuldig bei dem, was er da schrieb. Aber er mußte Gustav doch schützen!
Er wünschte, Marie würde mit ihm sprechen und er könnte sich ihr erklären. Wie eine Tochter war sie stets für ihn gewesen, niemals ein Mensch von geringerem Wert. Aber selbstverständlich: Wären die beiden keine Mißgeburten, wäre es ihm unmöglich gewesen, Gustav vor Strafe zu bewahren. Maries Gesicht war eine Maske, und ihre Augen starrten ins Leere.
Nur einmal in der letzten Woche war das Leben in sie zurückgekehrt. Das war nach der Beerdigung in Stolpe gewesen, als sie zu dem Schneider gegangen waren, bei dem Christian gewohnt hatte, und seine Sachen holten, unter denen ein Paket sich befand und darin ein äußerst kostbares Kleid, bei dem zweifelsfrei war, daß ihr Bruder es für ihre Maße angefertigt hatte. Die Überraschung darüber zerbrach für einen Moment die Starre, in die sie noch in der Nacht seines Todes gefallen war. Sie hatte das Kleid ausgebreitet und glücklich gelächelt und gar nicht mehr aufhören können, es zu betrachten, hielt es sich schließlich vor die Brust, und ihr Lächeln bekam etwas Triumphales, und dann begann sie fürchterlich zu weinen. Alle standen betreten dabei in dem kleinen Zimmer, und weil sie nicht aufhörte zu weinen, ging man hinaus. Als sie auf den Wagen stieg, war ihr Blick wieder starr. Christians andere Sachen kümmerten sie nicht, nur das Paket hielt sie fest umklammert.
Ferdinand Fintelmann wurde das Herz schwer, wenn er daran dachte, doch die Arbeit duldete keinen Aufschub. Mit einem Seufzer nahm er eines der Papiere auf, die vor ihm lagen, Professor Lichtenstein hatte ihm geschrieben. Er habe von den Verlusten an Tieren auf der Insel gehört und bitte um Aufklärung über den Tierbestand. Tatsächlich war die Lage nicht gut. Von den achthundertsechsundvierzig Tieren der letzten Zählung waren nur mehr sechshundertdreißig am Leben. In den letzten anderthalb Jahren waren so viele Affen gestorben, daß von seinerzeit elf Affenarten nur mehr fünf übrig waren, darunter Gott sei Dank die drei Mandrills, die mit ihren bunten Hinterteilen zu den auffallendsten Tieren der Menagerie gehörten. Von den Grauen Riesenkänguruhs, die noch vor Jahresfrist eine kleine Herde gebildet hatten, lebten nur noch vier.
Lichtenstein mahnte an, daß man bei etwaigen Todesfällen nichts wegwärfe, sondern die Cadaver in einem Faß mit schlechtem Brandwein oder Rum zusammen aufbewahrte, da sie dann noch immer eine gute Studie für die Anatomie abgäben, und Fintelmann überlegte, wie es zu bewerkstelligen sein könnte, zumindest die größeren Exemplare nach Berlin zu schicken, damit sie seziert und gegebenenfalls als Präparate für das Museum aufgearbeitet werden konnten, und schrieb einen entsprechenden Brief, in dem er dem Professor auch hinsichtlich einer anderen Sache antwortete, um die er ihn gebeten hatte. Er solle Untersuchungen mit den Känguruhs anstellen, da der Wissenschaft noch immer unklar sei, wie die Fortpflanzung und vor allem die Geburt bei diesen Tieren vonstatten gehe. Daher solle er für die Zeit, in welcher man den Übergang der Jungen in den Beutel erwarte, unausgesetzt Tag und Nacht Leute zur Beobachtung abstellen. Fintelmann wußte, bei all den Arbeiten, die auf der Insel anfielen, nicht, wer das übernehmen konnte, und quälte sich mit seiner Antwort. Er legte die Brille auf das Tischtuch und sah Marie an.
Читать дальше