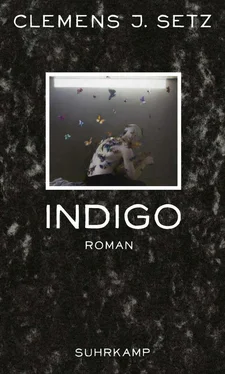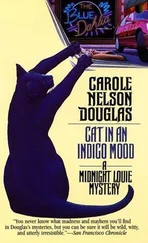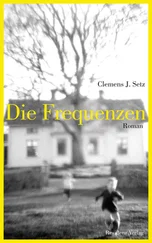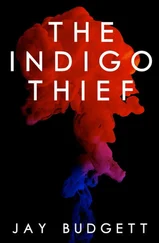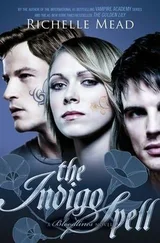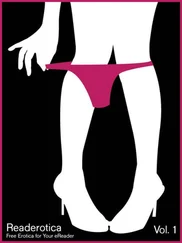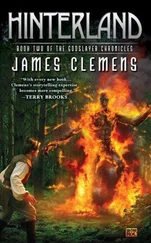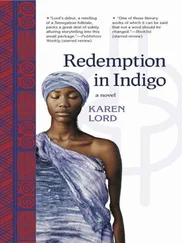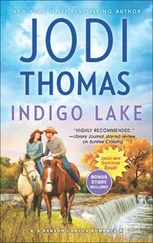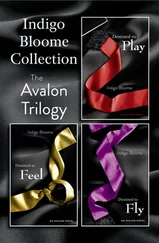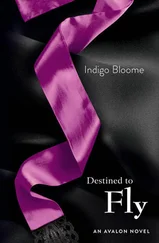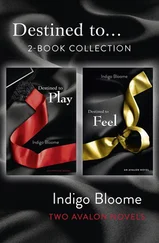— In Ordnung.
Ich stand auf. Wir gaben uns die Hand.
Frau Häusler-Zinnbret begleitete mich noch bis zur Tür, diesmal war es die andere. Ihre Wohnung hatte, wie mir jetzt klarwurde, separate Eingangs- und Ausgangstüren, wie ein Supermarkt oder ein Spiegelkabinett auf dem Rummelplatz.
Draußen war der Himmel so blau, dass man eine Stecknadel darin hätte fallen hören.
Zwei Wahrheiten
Nach dem Gespräch mit der Kinderpsychologin las ich ein wenig in dem Buch, das sie mir geschenkt hatte, der Neuauflage ihres Standardwerks. Die veraltete Version hatte ich aus der Uni-Bibliothek entlehnt. Einige interessante Seiten hatte ich mir kopiert und in meine rotkarierte Mappe gelegt.
Die neue Auflage unterschied sich nur wenig von der früheren. Der Ton schien an manchen Stellen etwas strenger, und es gab einen erweiterten Anhang, in dem Frau Häusler-Zinnbret eine Art Rückschau auf ihre bisherigen Studien veranstaltet. In ihrem typischen bild- und beispielhaften Stil schreibt sie:
Eine einsame Büste von Wladimir Iljitsch Lenin blickt in die Polarnacht. Das Denkmal befindet sich auf dem sog. Südlichen Pol der Unzugänglichkeit, dem geografisch am weitesten von der Küstenlinie entfernten Punkt der Antarktis (ca. 800 km entfernt vom Südpol). Früher standen noch ein paar Gebäude einer sowjetischen Forschungsstation um die Statue herum, heute ist sie ganz allein. Sie blickt nach Norden, d. h. in Richtung Moskau. Die Büste selbst steht auf dem Schornstein eines inzwischen ganz im Schnee versunkenen Häuschens, in dem vielleicht noch einige Geister aus der Vergangenheit leben, in endloser Diskussion über uralte Weltkarten gebeugt … Wie im Fall dieser einsamen Büste haben wir es, wenn wir Phänomene wie Dingo Pride oder den Ruf nach einer unzivilisierten Lösung des Indigo-Problems bedenken, immer mit zwei konkurrierenden Wahrheiten zu tun. Die evolutionäre Wahrheit (das unsichtbare, versunkene Fundament) hat allgemein das europäische Stadtbild geprägt: Ausgrenzung und Verwahrung von Kranken, Ansteckenden, Abweichenden etc. Wie bei den Erdmännchen, die einen kranken Artgenossen, der das erfolgreiche Weiterkommen des Rudels gefährden könnte, mit vereinten Kräften totbeißen oder ihn einfach zurücklassen. Kranke Katzen ziehen sich zurück, sterben allein, weil dieser Vorgang ohnehin nicht anders zu bewerkstelligen ist. Die evolutionäre Wahrheit sieht also vor, dass immer ein Teil der Population stirbt, um die Existenz des anderen Teiles zu ermöglichen. Die menschliche Wahrheit (der sichtbare Kopf) sagt: Alle müssen überleben, oder besser: Alle haben das Recht zu überleben. Es ist sinnlos, zu fragen: Warum? Die Frage ist nicht zu beantworten, außer mit Hilfskonstruktionen wie Mitleid und der Vermeidung von Schmerz. Der Grund liegt in unserem Gehirn, das sich in alles hineinleben, hineinversetzen kann, vor allem in die Dinge, vor denen es sich schützen muss: Krankheit, Leid und Tod. Es ist eine seltsame Folge der evolutionären Hochzüchtung unserer Denkkapazität, unserer Fähigkeit, uns differenzierte Bilder von fremden Existenzen zu machen, dass sich dadurch notwendigerweise ein von der evolutionären Logik emanzipiertes Denken entwickelt hat: die menschliche Moral, die nur in wenigen Punkten mit der evolutionären Logik zusammenfällt (z. B. Isolation von Menschen mit hochansteckenden Krankheiten, Seucheneindämmung etc.).
Ein anekdotischer Refrain unserer Zeit ist, dass I-Kinder auf gerade jenes In-andere-Wesen-Hineinversetzen verzichten oder zu verzichten gelernt haben. Der Beweis dieser Vermutung ist möglicherweise überall, sozusagen vor unserer Nase; trotzdem hat ihn bisher noch niemand gesehen, geschweige denn daraus Nutzen ziehen können.

Ich beugte mich über die Buchseite, um das winzige Foto der seltsamen Büste besser erkennen zu können. Aus dem Buch stieg ein merkwürdiger Geruch auf. Ich sog vorsichtig die Luft ein. Desinfektionsmittel.
Der Geruch beschwor eine Erinnerung herauf … Die Krankenstation im Helianau-Institut vor ein paar Wochen. Wenige Minuten nach meinem gespielten Sturz vor Dr. Rudolphs offenstehender Bürotür. Der Horror, der Horror.
Ein warmer Frühlingstag vor den Fenstern. Im Inneren des Gebäudes ist die Luft stickig, schwere, große Fensterflügel, die niemals geöffnet werden, in jedem Winkel der beißende Geruch nach frischem Lack und den aggressiven Bodenreinigungsmitteln, die angeblich jedes Wochenende von einer Putzkolonne mit Atemschutzmasken in den Korridoren der drei Stockwerke verteilt werden.
— Herr Setz? Sie sind hingefallen? Haben Sie sich verletzt?
— Nein, es ist nur der Kopf … Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen?
— Sie sehen wirklich nicht gut aus. Kommen Sie, setzen Sie sich hier hin. Und schauen Sie mich an. Sie sind sehr bleich, wissen Sie das?
— Das ist bei mir normal.
— Ihnen ist schwindlig geworden?
— Ja, vor meiner Tür, kurz nachdem er aus dem Büro gegangen ist, sagte Dr. Rudolph, der mich in die Krankenstation begleitet hatte.
— Tut mir leid, sagte ich.
— Na ja, sagte er, ich muss dann wieder zurück. Sie sind hier ja in guten Händen.
Er ging aus dem Zimmer.
— Sie sehen wirklich nicht gut aus, sagte die Krankenschwester zu mir. Und Sie haben Glück, dass ich noch da bin. Eigentlich wollte ich schon um elf Uhr weg …
— Wissen Sie was? sagte ich. Ich möchte Sie gern etwas fragen –
— Bitte kurz nicht reden, sagte sie und hielt mir ihren Handrücken an die Stirn.
Ich wartete. Ihre Augen wanderten zur Zimmerdecke.
— Na ja, sagte sie. Sie haben ein wenig erhöhte Temperatur. Haben Sie sich in irgendeiner Nähe aufgehalten?
Ich versuchte, ihrem Blick standzuhalten.
— Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, sagte ich. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass jemand, Sie wissen schon, deswegen zu Ihnen kommt?
Sie verdrehte wieder die Augen, zuckte die Achseln.
— Ach, na ja. Hm. Schwer zu sagen.
Dann ging sie zu ihrem Medizinschränkchen und griff nach einer Schachtel mit Tabletten.
— Ist es schon einmal vorgekommen?
Sie drückte eine Tablette in ihre Hand und reichte sie mir. Sie war weißgrau und erinnerte in ihrer Form an einen kleinen Zeppelin.
— Was ist das? fragte ich.
— Etwas gegen Ihre Kopfschmerzen.
— Hätten Sie ein Glas Wasser für mich?
Sie brachte es mir. Ich legte mir die Tablette unter die Zunge, trank das Glas in großen Zügen aus und verabschiedete mich von ihr mit einem Winken.
Im Korridor spuckte ich die Tablette aus und versteckte sie in der Erde der mickrigen Kletterpflanze, die in ihrem Topf vor einem der Fenster stand. Dann holte ich meine Sachen aus dem Lehrerzimmer und ging zu Fuß zum Bahnhof. Ich begegnete niemandem.
Vermutlich war das der Augenblick, da ich wusste, dass ich nicht mehr ins Institut zurückkehren würde, und nicht erst das kurze Handgemenge mit Dr. Rudolph am darauffolgenden Tag.
Julia traf mich, als sie von der Arbeit nach Hause kam, am Schreibtisch in merkwürdiger Erregung an. Sie brachte, als sie ins Zimmer kam, einen Geruch von rekonvaleszenten Fledermäusen und Ratten mit und fragte mich, weshalb ich mitten in der Woche schon so früh zu Hause sei. Sie hielt meine Aufregung zuerst für Angst und wollte wissen, ob ich wieder etwas Schlimmes im Fernsehen oder auf einer Abbildung in einem Buch gesehen hätte.
Cordulas Nacken, den sie sich in ihrer Panik ein wenig rotgekratzt hatte, roch nach damals. Er würde es nie wieder vergessen. Die drei langen Wochen in der Psychiatrie, die Zeit vor den Medikamenten, vor der Therapie und vor den Abenden, als sie sich zusammen einen blutigen Actionfilm oder ein altes Kung-Fu-Drama ansahen, in dem zu allem entschlossene Asiaten die unterschiedlichsten gewaltsamen Todesarten herbeiführten.
Читать дальше