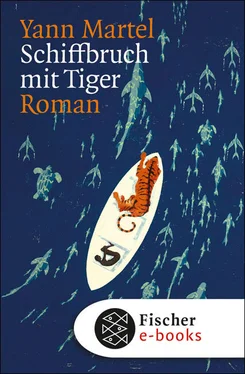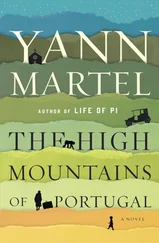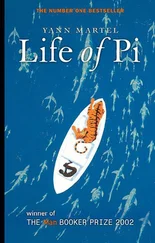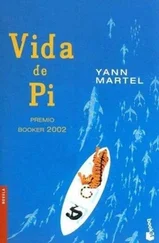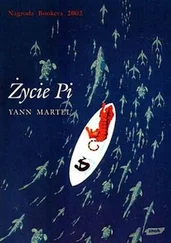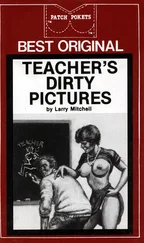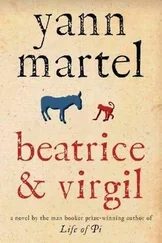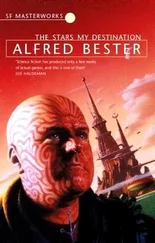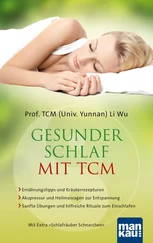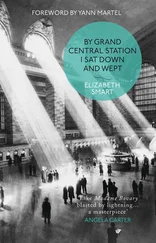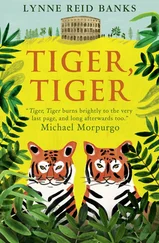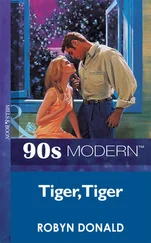Es ist sinnlos. Heute sterbe ich.
Heute werde ich sterben.
Ich sterbe.
Das war mein letzter Eintrag. Ich starb dann doch nicht, ich hielt auch weiterhin durch, aber ich schrieb nichts mehr. Hier, die Abdrücke, unsichtbare Kringel auf den Rändern der Seiten. Ich hatte immer befürchtet, mir würde das Papier ausgehen. Stattdessen hatten die Kugelschreiber keine Tinte mehr.
Kapitel 90
»Fehlt dir etwas, Richard Parker?«, fragte ich und fuhr mit der Hand vor seinem Gesicht auf und ab. »Bist du blind geworden?«
Seit ein oder zwei Tagen hatte er sich die Augen gerieben und unglücklich miaut, aber ich hatte mir nichts dabei gedacht. Schmerz und Leid waren ja für uns die einzige Ration, die immer reichlich vorhanden war. Ich fing eine Dorade. Seit drei Tagen hatten wir nichts mehr gegessen. Am Tag zuvor war eine Schildkröte vorbeigekommen, aber ich hatte nicht die Kraft gehabt, sie an Bord zu ziehen. Ich teilte den Fisch in zwei Hälften. Richard Parker blickte in meine Richtung. Ich warf ihm seinen Anteil zu. Ich hatte erwartet, dass er ihn elegant auffing. Er flog ihm mitten ins Gesicht. Er suchte den Boden ab. Er schnüffelte links und rechts, schließlich fand er ihn und machte sich langsam darüber her. Wir waren beide bedächtige Esser geworden.
Ich untersuchte seine Augen. Sie sahen nicht anders aus als am Tag zuvor. Vielleicht waren sie ein wenig stärker verklebt in den Ecken, aber es war nichts Dramatisches, jedenfalls gewiss nicht so dramatisch wie seine Erscheinung insgesamt. Wir waren beide nur noch Haut und Knochen.
Aber die bloße Tatsache, dass ich ihm ins Gesicht blickte, war ja schon die Antwort auf meine Frage. Ich starrte ihm in die Augen wie ein Augenarzt, und er blickte nur ausdruckslos zurück. Eine Wildkatze konnte nur blind sein, wenn sie sich ein solches Starren gefallen ließ.
Richard Parkers Schicksal bekümmerte mich. Unser Ende war nah.
Am nächsten Tag spürte ich ein Jucken in meinen eigenen Augen. Ich rieb und rieb, aber das Jucken ging nicht weg. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer, und anders als bei Richard Parker trat bei mir eine eitrige Flüssigkeit aus. Dann kam, so sehr ich die Augen auch zusammenkniff, die Dunkelheit. Zunächst war es nur ein schwarzer Punkt, direkt vor mir, immer genau in der Mitte. Daraus wurde ein Fleck, der wuchs, bis er mein ganzes Gesichtsfeld ausgefüllt hatte. Am nächsten Morgen sah ich von der Sonne nur noch einen schmalen Lichtstreif oben im linken Auge, wie ein winziges Fenster viel zu weit oben im Raum. Am Mittag war alles pechschwarz.
Ich klammerte mich ans Leben. Eine kraftlose Panik. Die Hitze war entsetzlich. Ich war so schwach geworden, dass ich nicht mehr auf den Beinen stehen konnte. Meine Lippen waren hart und schrundig. Der Mund war ausgetrocknet wie Pappe, überzogen mit einem zähflüssigen Speichel, der ebenso widerwärtig schmeckte wie er roch. Ich hatte Sonnenbrand am ganzen Körper. Jeder geschrumpfte Muskel tat mir weh. Meine Glieder, besonders die Füße, waren geschwollen und schmerzten ständig. Ich war hungrig, und wieder hatte ich nichts gefangen. Richard Parker brauchte so viel Wasser, dass ich meinen Anteil auf fünf Löffelvoll pro Tag beschränkte. Aber diese körperlichen Qualen waren nichts im Vergleich zu den seelischen, die jetzt erst begannen. Der Tag, an dem ich das Augenlicht verlor, war der erste Tag meiner neuen Leiden. An welchem Punkt unserer Seefahrt es geschah, könnte ich nicht sagen. Zeit spielte, wie gesagt, bald keine Rolle mehr. Irgendwann zwischen dem hundertsten und dem zweihundertsten Tag muss es gewesen sein. Und ich war sicher, dass jener Tag mein letzter sein würde.
Am nächsten Morgen hatte ich alle Furcht vor dem Tod überwunden, und ich beschloss zu sterben.
Ich kam zu dem traurigen Schluss, dass ich nicht mehr in der Lage war, für Richard Parker zu sorgen. Als Zoowärter hatte ich versagt. Dass er sterben sollte, machte mir mehr aus als mein eigener nahender Tod. Aber ich musste es einsehen, dass ich, mutlos und krank wie ich war, nichts mehr für ihn tun konnte.
Meine Kräfte nahmen rapide ab. Ich spürte, wie die Schwäche des Todes in mich hineinkroch. Den Nachmittag würde ich nicht überleben. Ich beschloss, dass ich mir den Abschied ein wenig leichter machen und wenigstens den quälenden Durst lindern würde, mit dem ich so lange gelebt hatte. Ich goss so viel Wasser in mich hinein, wie ich schlucken konnte. Hätte ich doch nur einen allerletzten Bissen zu essen gehabt. Aber das sollte wohl nicht sein. Ich lehnte mich an das zusammengerollte Ende der Plane. Ich schloss die Lider und wartete auf meinen letzten Seufzer. »Leb wohl, Richard Parker«, murmelte ich. »Verzeih mir, dass ich dich verlasse. Ich habe getan, was ich konnte. Behüt dich Gott. Vater, Mutter, Ravi, seid mir gegrüßt. Euer liebender Sohn und Bruder kehrt zu euch heim. Keine Stunde ist vergangen, in der ich nicht an euch gedacht hätte. Der Augenblick, in dem ich euch wiedersehe, wird der glücklichste meines Lebens sein. Und nun lege ich alles in die Hände Gottes, der Liebe ist und den ich liebe.«
Ich hörte eine Stimme sagen: »Ist da jemand?«
Es ist erstaunlich, was man alles hört, allein in der Finsternis eines sterbenden Verstands. Ein Geräusch ohne Form oder Farbe hört sich merkwürdig an. Blinde hören anders als Sehende.
Die Stimme fragte noch einmal: »Ist da jemand?«
Ich kam zu dem Schluss, dass ich den Verstand verloren hatte. Traurig, aber es konnte nicht anders sein. Das Elend wünscht sich einen Gefährten, und der Wahnsinn ruft ihn herbei.
»Ist da jemand?«, fragte die Stimme zum dritten Mal, nun schon strenger.
Verblüffend, wie klar mein Verstand im Delirium war. Die Stimme hatte ein ganz eigenes Timbre, einen schweren, müden, schleppenden Klang. Ich ging auf sie ein.
»Natürlich ist da jemand. Jemand ist immer da. Woher sollte denn sonst die Frage kommen?«
»Ich hatte gehofft, dass da vielleicht noch jemand ist.«
»Was soll das heißen, noch jemand? Begreifst du eigentlich, wo du hier bist? Wenn dir diese Frucht deiner Phantasie nicht schmeckt, dann pflück dir eben eine andere. Die sind hier so reichlich wie dein Entbehren.«
Hmmm. Ent behren? Erd beeren. Das wäre jetzt genau das Richtige.
»Da ist also niemand?«
»Pssst ... ich träume von Erdbeeren.«
»Erdbeeren! Hast du etwa welche? Bitte, kann ich eine haben? Ich flehe dich an. Oder ein Stückchen. Ich bin fast verhungert.«
»Und ob ich welche habe. Es könnte ein Erdbeben geben von so viel Erdbeeren.«
»Ein Erdbeben von Erdbeeren! Bitte, kann ich welche haben? Mein Entbehren ...«
Die Stimme, oder was es sonst als Täuschung von Wind und Wellen sein mochte, verklang.
»Dicke, runde, saftige, duftende Erdbeeren«, fuhr ich fort. »Ich habe sie direkt hier vor meinem Mund, so schwer hängen sie an ihren Stängeln. Die ganze Pflanze liegt am Boden, so schwer lasten sie auf ihr. Da sind bestimmt dreihundert Erdbeeren in meinem Beet.«
Schweigen.
Die Stimme kehrte zurück. »Lass uns über Essen reden ...«
»Das ist eine gute Idee.«
»Was würdest du gern essen, wenn du haben könntest, was du willst?«
»Ausgezeichnete Frage. Ich würde mir ein riesiges Büfett aufbauen. Anfangen würde ich mit Reis und Sambar. Es gäbe Reis mit Kichererbsen und Pulau-Reis und -«
»Ich hätte gern -«
»Ich bin noch nicht fertig. Zu meinem Reis gäbe es einen würzigen Tamarindensambar und einen Frühlingszwiebelsambar und -«
»Noch mehr?«
»Wart's nur ab. Ich würde noch Sagu mit gemischten Gemüsen nehmen und Gemüsekorma und Kartoffelmasala und Weißkohlvadai und Masala Dosai und scharfen Linsenrasam und -«
»Ah ja.«
»Warte. Und Porial mit gefüllten Auberginen und Kokosnuss-Jamswurzel-Kootu und Idlireis und Dani Vadai und Gemüsebhaji und -«
Читать дальше