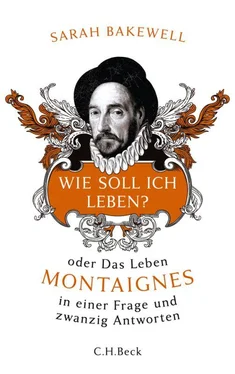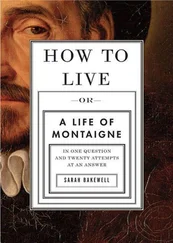Seneca hatte bei seiner Empfehlung, sich zurückzuziehen, auch vor Gefahren gewarnt. In seinem Dialog Die Ruhe der Seele schrieb er, Untätigkeit und Abkapselung brächten alle Auswirkungen einer falschen Lebensführung zum Vorschein — Auswirkungen, denen sich der Mensch gewöhnlich dadurch entziehe, dass er sich beschäftigt halte, also dieses falsche Leben weiterführe. Zu den Symptomen gehörten Unzufriedenheit, Selbsthass, Angst, Unentschlossenheit, Lethargie und Melancholie. Das Tätigsein aufzugeben bringe geistige Übel hervor, besonders wenn man anfange, zu viele Bücher zu lesen — oder, noch schlimmer, die Bücher nur zur Repräsentation auslege, um damit zu prahlen.
Anfang der 1570er Jahre, als Montaigne seine Wertvorstellungen neu ordnete, erlebte er offenbar genau die existentielle Krise, vor der Seneca warnte. Er hatte zwar zu tun, dennoch aber weniger Aufgaben zu erfüllen als vorher. Dieser Müßiggang brachte ihn auf seltsame Gedanken und führte zu «einer melancholischen Gemütsverfassung», die gar nicht seinem Naturell entsprach. Sobald er sich zurückgezogen hatte, sagte er, sei sein Geist losgaloppiert wie ein durchgegangenes Pferd — ein naheliegender Vergleich, wenn man bedenkt, was ihm kurz zuvor zugestoßen war. Sein Kopf sei mit abstrusen Gedanken erfüllt gewesen, die wucherten wie Unkraut auf brachliegenden Äckern. In einem anderen eindringlichen Bild — er steigerte die Wirkung gern, indem er solche Bilder aneinanderreihte — verglich er den müßigen Geist mit dem Schoß einer Frau, der, wenn er nicht mit gutem Samen gleichsam bestellt werde, nur Klumpen unförmigen Fleisches hervorbringe, so jedenfalls die zeitgenössische Vorstellung. Und in einem Vergil entnommenen Bild verglich er seine Gedanken mit den Mustern, die über die Zimmerdecke tanzen, wenn sich das Sonnenlicht auf der Oberfläche einer mit Wasser gefüllten Schüssel bricht. Wie das zitternde Licht den Raum durchflirrt, so werfe sich auch ein untätiger Geist ziellos hin und her und erzeuge im grenzenlosen Feld der Einbildungen fantaisies oder rêveries — Begriffe, die damals eine weniger positive Konnotation hatten als heute und eher Wahngebilde, Hirngespinste bezeichneten als Tagträume.
Seine rêverie brachte Montaigne auf einen weiteren absonderlichen Gedanken: die Idee zu schreiben. Er spricht zwar auch hier von rêverie , aber sie enthielt immerhin das Versprechen eines tätigen Geistes. Erfüllt von «Schimären und phantastischen Ungeheuern, immer neuen, ohne Sinn und Verstand», beschloss er, über diese Hirngespinste zu schreiben, nicht um sie loszuwerden, sondern um ihre Eigenart besser zu verstehen. Und so nahm er die Feder zur Hand. Der erste Essai war geboren.
Seneca wäre zufrieden gewesen. Wenn man nach seinem Rückzug aus dem öffentlichen Leben niedergeschlagen oder gelangweilt war, so empfahl er, solle man sich umsehen und sich für die Vielfalt und Erhabenheit der Dinge ringsum interessieren. Die Rettung liege in der umfassenden Aufmerksamkeit für die Natur der Erscheinungen. Und Montaigne wandte sich dem ihm am nächsten liegenden Naturphänomen zu: sich selbst. Er begann, sich selbst zu betrachten, seine eigenen Erfahrungen zu hinterfragen und aufzuschreiben, was er dabei beobachtete.
Zunächst folgte er seinen persönlichen Vorlieben, besonders den Geschichten, die er gelesen hatte: Erzählungen von Ovid, historischen Beschreibungen von Caesar und Tacitus, biographischen Abrissen von Plutarch, Ratschlägen zur Lebenskunst von Seneca und Sokrates. Dann schrieb er Geschichten auf, die er von Freunden gehört hatte, alltägliche Vorfälle von seinem Landgut, Begebenheiten, die er noch aus seiner Zeit am Gericht und in der Politik in Erinnerung hatte, sowie Merkwürdigkeiten, deren Zeuge er auf seinen (bis dahin nicht sehr weiten) Reisen geworden war. Das waren seine bescheidenen Anfänge. Später kam immer mehr Stoff hinzu, bis er fast das ganze Spektrum seines Fühlens und Denkens abschritt, nicht zuletzt seine merkwürdige Reise in die todesähnliche Bewusstlosigkeit.
Der Gedanke an eine Veröffentlichung mag ihm schon früh gekommen sein, auch wenn er behauptete, er habe nur für Angehörige und Freunde geschrieben. Vielleicht begann er sogar mit der Absicht, ein Kollektaneenbuch zu schreiben, eine Sammlung thematisch geordneter Zitate und Geschichten, wie es zu jener Zeit populär war. Wenn dies der Fall war, so gab er die Idee bald wieder auf, womöglich unter dem Einfluss jenes Schriftstellers, den er neben Seneca am meisten schätzte: Plutarch. Plutarch hatte im 1. Jahrhundert n. Chr. anschauliche Biographien historischer Gestalten, die Vitae , geschrieben sowie die kürzeren Abhandlungen der Moralia , die im selben Jahr ins Französische übersetzt wurden, in dem Montaigne mit seinen Essais begann. Es waren Gedanken und Geschichten zu Fragen wie: «Können Tiere als vernünftig bezeichnet werden?» oder «Wie gelangt man zu innerem Frieden?» Plutarch hielt hierzu denselben Rat bereit wie Seneca: Konzentriere dich auf das, was vor dir liegt, und schenke ihm deine ganze Aufmerksamkeit.
Im Laufe der 1570er Jahre richtete sich Montaigne immer besser in seinem Leben nach der Krise ein, und seine Aufmerksamkeit zu fokussieren wurde seine liebste Beschäftigung. Das produktivste Jahr war 1572, in dem er die meisten Essais des ersten und Teile des zweiten Buches schrieb. Der Rest folgte 1573 und 1574. Bis er so weit war, die Essais zu veröffentlichen, dauerte es aber noch lange. Vielleicht spielte er tatsächlich zunächst nicht mit dem Gedanken, vielleicht war er erst nach all den Jahren mit dem Ergebnis seines Schreibens zufrieden. Zwischen seinem Rückzug ins Privatleben im Jahr 1570 und dem 1. März 1580, dem Tag nach seinem siebenundvierzigsten Geburtstag, als er das Vorwort zur ersten Ausgabe der Essais abschloss, die ihn über Nacht berühmt machten, liegen jedenfalls zehn Jahre.
Schreibend hatte Montaigne seine «Hirngespinste» und «Wahngebilde» überwunden. Jetzt beobachtete er die Welt genauer und entwickelte die Gewohnheit, innere Empfindungen und soziale Begegnungen sehr präzise zu beschreiben. Hierfür war Plinius sein Gewährsmann: «Jedermann, sagt Plinius, sei sich selbst der beste Lehrmeister, vorausgesetzt, er habe die Fähigkeit, sich genau zu beobachten.» Montaigne, der Mensch, der seinen alltäglichen Verrichtungen auf seinem Gut nachging, wurde stets von dem Schriftsteller Montaigne begleitet, der alles ausforschte und notierte.
Als er daher schließlich über seinen Reitunfall schrieb, ging es ihm nicht nur darum, die noch verbliebene Todesfurcht loszuwerden wie Sand, den man aus seinen Schuhen schüttelt, sondern auch darum, seine Selbsterforschung auf ein ihm bis dahin unbekanntes Niveau zu heben. So, wie er sich in den Tagen nach seinem Unfall immer wieder von seinen Bediensteten den Hergang erzählen ließ, so muss er jetzt seinen Geist erforscht haben, um jenes Hinübergleiten von damals nachzuerleben, als sein Atem oder sein Geist im Begriff war, seinen Körper zu verlassen, aber auch den Schmerz der Rückkehr ins Leben. Diese Erfahrung «verarbeitete» er, wie Psychologen heute sagen würden, indem er darüber schrieb. Er rekonstruierte die Geschichte, wie er sie tatsächlich erlebt hatte, nicht, wie man sie philosophisch korrekt erleben sollte.
Dieses neue Hobby war kein Zeitvertreib. Montaigne behauptete immer wieder, er habe die Essais unbekümmert hingeworfen, aber manchmal legte er diese Pose ab und gestand, dass es harte Arbeit war:
Es ist ein schwieriges Unterfangen — und dies weit mehr, als es scheint —, der so schweifenden Bewegung unsres Geistes bis in seine tiefsten und dunkelsten Winkel zu folgen und noch seine winzigsten Windungen und Wendungen auszumachen und aufzuzeichnen; und es ist zugleich eine völlig ungewöhnliche Beschäftigung, die uns von den gewöhnlichen Weltgeschäften abzieht.
Читать дальше