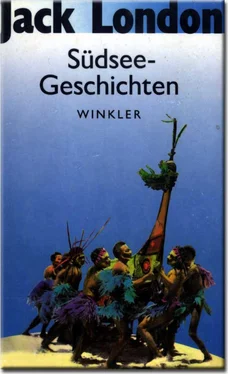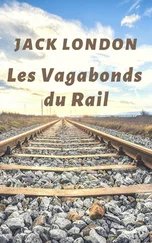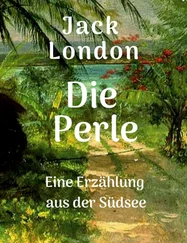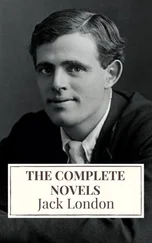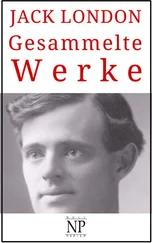Die Stunden verrannen, die Offiziere lachten und tanzten, das Eingeborenenorchester spielte weiter, und Percival Ford kämpfte mit dem jäh aufgetauchten und überwältigenden Problem, das ihm aufgebürdet worden war. Er betete still, den Ellbogen auf den Tisch gestützt, den Kopf in die Hand gelegt, so daß er den Anschein eines müden Zuschauers erweckte. Zwischen den Tänzen kamen die Militärs mit ihren Damen und die Zivilisten zu ihm heraufgeschwärmt und überfielen ihn mit dem üblichen nichtssagenden Geplauder, und wenn sie dann auf den Lanai zurückkehrten, nahm er seinen Kampf dort wieder auf, wo er ihn unterbrochen hatte.
Er begann sein lädiertes Idealbild von Isaac Ford wieder zusammenzuflicken, und als Kitt benutzte er eine ausgeklügelte und verzwickte Logik. Sie war von der Art, wie sie in den Geheimlaboratorien von selbstgefälligen Menschen, von Egoisten, konstruiert wird, und sie tat ihre Wirkung. Es war unbestritten, daß sein Vater aus einem feineren Holz geschnitzt war als die Menschen, die ihn umgaben; aber doch war der alte Isaac erst im Prozeß des Werdens begriffen, während er, Percival Ford, bereits vollendet war. Zum Beweis rehabilitierte er seinen Vater und erhöhte dadurch gleichzeitig sich selbst. Sein mageres kleines Ego blähte sich zu ungeheuren Dimensionen auf. Er war groß genug, um zu verzeihen. Bei dem Gedanken glühte er vor Stolz. Isaac Ford war groß gewesen, doch er war größer, denn er konnte Isaac Ford vergeben und ihn sogar wieder in den heiligen Schrein seines Andenkens einsetzen, wenn auch dieser Schrein nicht mehr ganz so heilig war wie vordem. Auch zollte er Isaac Ford dafür Beifall, daß er die Folge seines einzigen Fehltritts ignoriert hatte. Sehr gut, er würde sie auch ignorieren.
Der Tanzabend ging zu Ende. Die Kapelle hatte »Aloha Oe« gespielt und schickte sich an, nach Hause zu gehen. Percival Ford klatschte in die Hände, um den japanischen Diener herbeizurufen.
»Sag dem Mann dort, daß ich mit ihm reden will«, befahl er und zeigte auf Joe Garland. »Sag ihm, er soll herkommen, sofort.«
Joe Garland näherte sich und blieb respektvoll in einigen Schritten Entfernung stehen, wobei er nervös an seiner Gitarre zupfte, die er immer noch umhängen hatte. Der andere bot ihm keinen Platz an.
»Du bist mein Bruder«, sagte er.
»Ja, das weiß doch jeder«, lautete die verwunderte Antwort.
»Wie ich höre, stimmt das«, sagte Percival Ford kühl. »Aber ich habe es bis zum heutigen Abend nicht gewußt.«
Der Halbbruder wartete unbehaglich in dem Schweigen, das nun folgte, während Percival Ford gelassen überlegte, was er als nächstes sagen würde.
»Erinnerst du dich noch daran, als ich zum ersten Mal in die Schule kam und die Jungen mich untertauchten?« fragte er. »Warum hast du für mich Partei ergriffen?«
Der Halbbruder lächelte verlegen.
»Weil du es wußtest?«
»Ja, deshalb.«
»Aber ich wußte es nicht«, bemerkte Percival Ford in demselben kühlen Ton.
»Ja«, sagte der andere.
Wieder trat Schweigen ein. Diener begannen die Lichter auf dem Lanai zu löschen.
»Sie wissen. es jetzt«, sagte der Halbbruder schlicht.
Percival Ford runzelte die Stirn. Dann musterte er den anderen nachdenklich.
»Wieviel muß ich dir geben, damit du die Insel verläßt und nie wiederkommst?« wollte er wissen.
»Nie wiederkommen?« stammelte Joe Garland. »Das ist das einzige Land, das ich kenne. Andere Länder sind kalt. Ich kenne keine anderen Länder. Hier habe ich viele Freunde. In anderen Ländern würde keine einzige Stimme zu mir sagen: >Aloha, Joe, mein Junge<.«
»Ich sagte, damit du nie wiederkommst«, wiederholte Percival Ford. »Die Alameda läuft morgen nach San Francisco aus!«
Joe Garland war bestürzt.
»Aber weshalb?« fragte er. »Sie wissen jetzt, daß wir Brüder sind.« »Eben deshalb«, war die Antwort. »Wie du selbst sagtest: Alle Leute wissen es. Ich werde dich gut dafür bezahlen.«
Alle Unbeholfenheit und Verlegenheit fiel von Joe Garland ab. Die durch Geburt und Rang bedingte Ungleichheit wurde überbrückt, ja umgekehrt.
»Sie möchten, daß ich fortgehe?« fragte er.
»Ich möchte, daß du fortgehst und nie mehr zurückkehrst«, erwiderte Percival Ford.
Und in diesem einen flüchtigen Moment war ihm eine Vision beschieden, in der sein Bruder ihn wie ein Berg überragte und er selbst einschrumpfte und zu mikroskopischer Bedeutungslosigkeit verkümmerte. Aber die Wahrheit bekommt einem Menschen nicht, und keiner kann sich lange so wahrnehmen und dabei am Leben bleiben; und nur in diesem einzigen, flüchtigen Augenblick sah Percival Ford sich und seinen Bruder unverzerrt. Im nächsten Moment wurde er schon wieder von seinem mageren, unersättlichen Ego beherrscht.
»Wie ich schon sagte, es wird sich für dich lohnen. Es soll dein Schaden nicht sein. Ich will dich gut dafür bezahlen.«
»Schön«, sagte Joe Garland. »Ich werde abreisen.«
Er wandte sich zum Gehen.
»Joe«, rief der andere. »Du kannst morgen früh meinen Anwalt aufsuchen. Fünfhundert sofort und zweihundert jeden Monat, solange du fortbleibst.«
»Sie sind sehr freundlich«, entgegnete Joe Garland sanft. »Zu freundlich, aber wie dem auch sei, ich will Ihr Geld nicht. Ich fahre morgen mit der Alameda ab.«
Er ging davon, ohne Lebewohl zu sagen.
Percival Ford klatschte in die Hände.
»Boy«, sagte er zu dem Japaner, »eine Limonade.«
Und über seiner Limonade lächelte er lange und zufrieden in sich hinein.
Ich begegnete ihm zum erstenmal in einem Orkan, und obwohl wir diesen Orkan auf demselben Schoner durchgestanden hatten, bekam ich ihn erst zu Gesicht, als das Schiff unter unseren Füßen in Stücke gegangen war. Zweifellos hatte ich ihn vorher unter der Kanakenmannschaft an Bord gesehen, doch seine Existenz nicht zur Kenntnis genommen, da die Petite Jeanne ziemlich vollgestopft war. Neben ihren acht oder zehn eingeborenen Matrosen, dem weißen Kapitän, dem ebenfalls weißen Steuermann und Frachtaufseher und den sechs Kajütrei senden war sie mit etwa fünfundachtzig Deckpassagieren von Rangiroa ausgelaufen - Eingeborenen aus Paumotu und Tahiti, Männern, Frauen und Kindern, die allesamt mit Kisten und Kästen ausgestattet waren, um von den Schlafmatten, Decken und Kleiderbündeln erst gar nicht zu reden.
Die Zeit der Perlenfischerei auf den Paumotu-Inseln war vorüber, und alle Saisonarbeiter kehrten nach Tahiti zurück. Wir sechs Kajütpassagiere waren Perlenaufkäufer. Zwei von uns waren Amerikaner, einer war Ah Choon (der weiseste Chinese, der mir je begegnet ist), einer war Deutscher, einer ein polnischer Jude, und ich machte das halbe Dutzend voll.
Es war eine erfolgreiche Saison gewesen. Keiner von uns hatte Grund zu klagen, die fünfundachtzig Deckpassagiere eingerechnet. Alle hatten gut verdient, und alle freuten sich auf eine Verschnaufpause und eine vergnügliche Zeit in Papeete.
Natürlich war die Petite Jeanne überladen. Sie hatte nur siebzig Tonnen und hätte von Rechts wegen nicht einmal ein Zehntel dieser Menschenmenge mit an Bord nehmen dürfen.
Unter Deck war sie bis zum Rande mit Perlmutt und Kopra vollgepfropft. Selbst das Warenlager hatte herhalten müssen. Es war ein Wunder, daß die Matrosen überhaupt die Segel bedienen konnten. Auf den Decks war kein Vorwärtskommen. So hangelten sie sich einfach an der Reling entlang.
In der Nacht stiegen sie über die Schläfer, die, mein Wort darauf, in zwei Schichten übereinander lagen. Ach, und dann waren da auch noch Schweine und Hühner an Deck und Säcke mit Yamswurzeln; und jedes freie Fleckchen war mit Girlanden aus Trinkkokosnüssen und Bananenbüscheln behängt. Zwischen den Fock- und den Großmastwanten hatte man auf beiden Seiten Geitaue gespannt, gerade so hoch, daß die Baumfock noch übergehen konnte, und auch von jedem dieser Taue baumelten mindestens fünfzig Bananenstauden.
Читать дальше