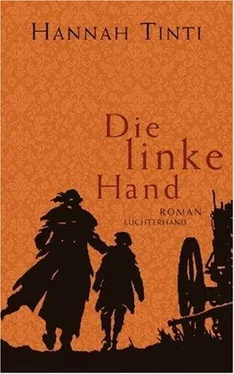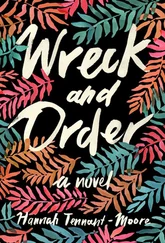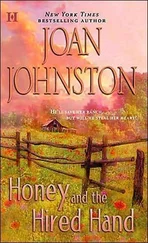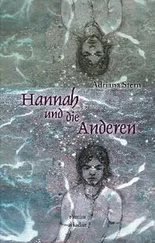»Ich bin nicht anders als alle anderen«, sagte Dolly.
»Doch, das seid Ihr«, sagte Doktor Milton, während er mit einer Schere herumfuchtelte. Ren sah ihm an, dass er noch immer Angst hatte. »Ihr seid ein Mörder. Eine Abscheulichkeit.«
Die Schere blinkte wie ein Signal.
»Die Männer, die wir gebracht haben, waren auch Mörder«, sagte Ren.
Doktor Milton war zwar nicht völlig beruhigt, wurde aber doch neugierig. »Haben sie Familie? Jemanden, der womöglich nach ihnen sucht?«
Ren schaute dem Arzt direkt in die Augen. »Nein.«
»Ich werde nicht den regulären Preis bezahlen«, sagte Doktor Milton. »Aber erst muss dieser Mann von hier verschwinden.«
»Ich lasse Ren nicht allein hier«, sagte Dolly.
Ren legte ihm die Hand auf den Arm. »Es ist nur für ein paar Minuten«, sagte er. »Warte draußen auf mich.«
Dolly ließ seine wuchtigen Knöchel knacken, so laut, dass es von der Decke widerhallte. Er warf Doktor Milton einen drohenden Blick zu, dann wuchtete er seinen Körper nach vorn und vom Operationstisch herunter. Ren schaute seinem Freund nach, und als er sich umdrehte, hatte Doktor Milton bereits eine Schlinge für seinen Arm geknüpft. Umständlich kramte er seine Geldbörse hervor und drückte Ren das Geld in die Hand. Es war weniger als ein Drittel dessen, was sie beim letzten Mal bekommen hatten.
»Du bist ein aufgeweckter Junge«, sagte er. »Ich weiß nicht, was du mit einem Mann wie dem da willst.«
»Er ist mein Freund«, sagte Ren.
»Du solltest zur Schule gehen. Du könntest Naturwissenschaften studieren. Oder dir eine Arbeit suchen. Etwas Anständiges.«
Die Möglichkeiten fächerten sich vor Ren auf wie Karten auf einem Spieltisch, dann schoben sie sich wieder zusammen, bis nur eine Alternative übrig blieb. Er würde nie Naturwissenschaften studieren; er würde nie ein anständiges Leben führen. Im günstigsten Fall konnte er den Weg einschlagen, den Benjamin ihm gezeigt hatte. Da gehörte er hin. Und er hatte es satt, sich Mühe zu geben, brav zu sein.
»Ich möchte nicht, dass er noch mal hierherkommt«, sagte Doktor Milton. »Es sei denn, du lieferst seinen Leichnam hier ab. Dafür würde ich extra bezahlen.«
Ren versuchte sich vorzustellen, wie Dollys Skelett neben dem des Riesen hing. »Das würde ihm bestimmt nicht gefallen.«
»Braucht es auch nicht«, sagte der Arzt. »Er braucht nur zu sterben.«
Auf der Suche nach den Socken des kleinen Mannes durchwühlten Ren und Dolly Mrs. Sands’ Schubladen und stießen dabei auf Berge von Nachthemden. Ren staunte über die Menge an Unterwäsche, denn er hatte die Hauswirtin nur in zwei Kleidern gesehen: einem purpurroten und einem braunen. In ihrem Schrank entdeckte er noch ein drittes, aus leichter grauer Seide geschneidert, das vermutlich ihr Hochzeitskleid war; es war in Papier eingeschlagen und mit einer Schnur zusammengebunden.
Während sie suchten, überlegte Ren die ganze Zeit, was er Tom und Benjamin sagen sollte. Er hätte ihnen gern von Dollys Mordtaten unter der Straßenlaterne erzählt, hatte aber Angst, sie könnten ihn zum Teufel jagen. Und außerdem fehlte das Geld aus dem Bettpfosten. Irgendeine Begründung würde Benjamin dafür haben wollen, doch je angestrengter Ren versuchte, sich etwas einfallen zu lassen, desto leerer wurde sein Kopf.
Dolly öffnete eine kleine Schachtel mit Bändern; sie waren aufgerollt und jeweils mit einer Nadel zusammengesteckt. Er zog eins nach dem anderen heraus, bis sie sich in Spiralen über die Kommode ringelten. Er schaute in den Spiegel, der über dem Toilettentisch hing. »Ren«, sagte er. »Schau mal!«
Auf dem Querbalken über ihren Köpfen stapelte sich ein Berg verstaubtes Spielzeug, das nur darauf wartete, entdeckt zu werden: eine Marionette in Gestalt eines Affen, eine Flotte Wikingerschiffe, geschnitzte Großbuchstaben, winzige Schweinchen, eine mondförmige Maske, ein Schloss mit einem Drachen und mehrere Fische, die alle ineinander steckten, angefangen beim Hai, der bis hinunter zur Elritze alles verschluckte. Dolly hob Ren auf seine Schultern, und gemeinsam befreiten sie einen Fisch nach dem anderen und breiteten alle Spielsachen auf dem Bett aus.
Ren ging in sein Zimmer, um das hölzerne Pferd zu holen, das er dort versteckt hatte, und legte es neben all die anderen geschnitzten Spielsachen. Ohne Zweifel stammte es von derselben Hand. Von den spitzen Winkeln der Ohren bis hin zu dem abgeflachten Gesicht ähnelte das Pferd allen anderen Tieren. So übel kann der Zwerg nicht sein, dachte Ren, wenn er das alles gemacht hat.
In einer Truhe am Fußende des Bettes entdeckten sie einen Beutel mit einem Strickzeug. Darunter, in ein Stück steifes Leinen eingewickelt, lag ein Paar durchgescheuerte saubere Socken. Fersen und Zehenspitzen waren ausgefranst. Ren konnte am Muster erkennen, wo sie bereits mehrmals gestopft worden waren. Er hielt sie hoch und erkannte die Größe und die besondere Machart wieder. Er war nicht der Einzige, der die Kleider des ertrunkenen Jungen trug.
Dolly durchwühlte den Beutel mit dem Strickzeug. Er förderte ein Knäuel Garn zutage, mehrere Stopfnadeln und eine winzige Schere. »Ich brauche einen abgerundeten Bettpfosten.«
»Wofür?«
»Um die Socken zu stopfen.«
Sie gingen wieder in ihr Zimmer, und Dolly stülpte eine ausgefranste Socke über den Knauf auf dem Bettpfosten. Dann fädelte er Garn in eine Nadel und machte entlang den ausgefransten Rändern lauter kleine senkrechte Vorderstiche. Als er damit fertig war, verband er die Stiche auf beiden Seiten mit einem längeren Stück Garn so, dass ein Gitter entstand. Er verknotete das Garn und fädelte es dann – mal oben, mal unten – waagrecht durch die Gitterstäbe.
»Wo hast du denn das gelernt?«
»Das hat mir meine Mutter beigebracht.« Ren sah zu, wie unter Dollys Händen ein gleichmäßiges Muster entstand. Schwer zu glauben, dass Dolly je eine Mutter gehabt hatte. Er stopfte die Socken ebenso systematisch, wie er die Männer unter der Straßenlaterne umgebracht hatte – gekonnt und ohne jede Gefühlsregung. Er bewegte die Nadel hin und her, bis er über das Loch in der Zehe ein feines Netz gesponnen hatte. Mit der Ferse verfuhr er ebenso und zählte dabei leise die Reihen.
»Warum, glaubst du, kümmert sie sich um ihn?«, fragte Ren.
»Das weiß ich nicht«, sagte Dolly.
»Ich wette, er hat irgendwas Schreckliches angestellt.«
»Er ist doch nur ein Zwerg«, sagte Dolly. »Ich glaube nicht, dass er recht viel angestellt haben kann.« Dolly legte die erste Socke beiseite und stülpte die zweite über den Bettpfosten. Er befeuchtete das Garnende mit den Lippen und fädelte es mit seinen gewaltigen Fingern durchs Nadelöhr. Nun machte er sich an die durchgescheuerte Ferse. Während er Faden an Faden reihte, verschwand der Bettknauf allmählich. Ren dachte an all die schrecklichen Dinge, die Dolly getan hatte. Und an all die schrecklichen Dinge, die er noch tun musste.
»Hast du immer noch vor, ihn umzubringen?«, fragte er.
»Wen?«
»Den Mann, für den sie dich angeheuert haben.«
»Besser wär’s.«
»Und warum?«
»Weil ich das Geld schon gekriegt habe.« Er zog die fertige Socke vom Bettpfosten und gab sie Ren. »Und er weiß, dass ich hinter ihm her bin. Wenn ich ihn nicht kriege, kriegt er mich.«
Dolly kroch an seinen Platz unter dem Bett. »Jetzt bin ich müde. Vielleicht mach ich es morgen.«
Ren beugte sich über den Rand der Matratze. »Und wie?«
Dolly lag so zusammengequetscht unterm Bett, dass seine Stirn beinahe die Holzlatten berührte. »Ich brech ihm das Genick. Das ist das Einfachste.«
»Du nimmst also kein Schießeisen?«
»Macht zu viel Lärm.«
Ren ließ sich auf die Matratze zurücksinken. Er zog sich eine von Mrs. Sands’ Steppdecken bis über beide Schultern und sah zu, wie die Spätnachmittagssonne über die Wände wanderte. »Und wenn ich dich bitten würde, ihn nicht umzubringen?«
Читать дальше