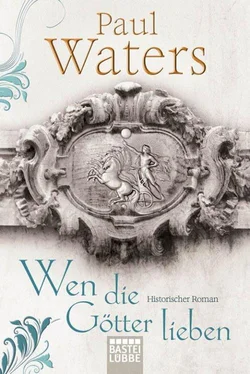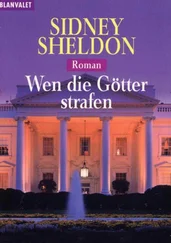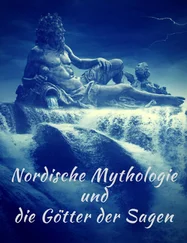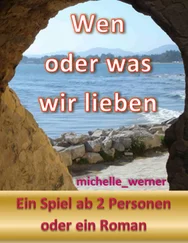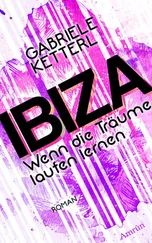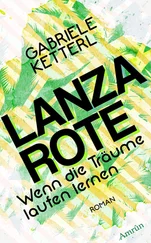»Ja«, bekannte er schließlich und sah mich mit fiebrigen Augen an. »Ja, das weiß ich wohl.«
Wieder schwieg er. Dann sagte er: »Am Ende sind die großen Entscheidungen ganz einfach. Sag Julian, ich vertraue ihm meine Frau und mein ungeborenes Kind an. Ihm wurde Unrecht angetan, und das kann ich durch nichts wiedergutmachen. Lass ihn herrschen, obwohl es ihm widerstrebt. Ihm übertrage ich das Reich.«
»Nein!«, rief der Oberkämmerer. »Das darf nicht sein!«
»Genug! Ich habe gesprochen, und du wirst diesem Mann gehorchen. Lass es von den Schreibern niederschreiben, denn das ist mein Testament.« Dann sah er mich noch einmal an und fügte mit freundlicherer Stimme hinzu: »Und es ist zugleich meine Beichte. Wirst du Julian das sagen? Er wird es verstehen.«
»Ja, das werde ich.«
Constantius nickte.
Dann wandte er sich seiner Gattin zu und sagte: »Fürchte nichts, Faustina. Er ist ein Freund Julians. Er wird dich mit Achtung behandeln.«
Ich traf den Notar in seinem Pavillon an. Bei ihm war ein grau gekleideter Sklave, der Schriftrollen und andere Dokumente in eine Reisetruhe packte. Paulus saß an einem Klapptisch; vor ihm stand ein offenes Kästchen, in das er behutsam kleine verstöpselte Flaschen einsortierte.
Als ich eintrat, drehte er sich um. »Du kommst allein«, stellte er mit amüsiertem Unterton fest. Sein Blick fiel auf den Dolch an meinem Gürtel. »Du bist kein Gefangener mehr, wie ich sehe. Dann ist Constantius tot?«
»Ja. Er ist tot.«
Er neigte leicht den Kopf.
Der Sklave hatte seine Tätigkeit unterbrochen. Ohne ihn anzusehen, sagte Paulus: »Lass uns allein, Candidus, wir haben etwas Persönliches zu besprechen.« Und nachdem der Sklave hinausgeeilt war: »Ich kenne dich besser als du dich selbst. Das ist meine Stärke. Du wirst mich verschonen, im Namen deiner törichten Auffassung von Rechtschaffenheit.«
»Da irrst du dich.«
Er lächelte. »Das glaube ich nicht. Außerdem scheint mir, dass ich dir jetzt diene – dir und deinem Freund Julian. Eben noch Verräter, nun ein Kaiser. Namen bedeuten so wenig und doch so viel. Du siehst, mein junger Freund, welche Lehre sich hier erschließt: Das einzig Wahre ist die Macht. Wie man sie gewinnt und wie man sie behält.«
»Ich habe keine Verwendung für dich. Und Julian auch nicht.«
»Du täuschst dich, du weißt es nur noch nicht. Du bist wie ein armer Mann, der eine große Erbschaft macht. Du siehst das viele Gold und spürst seine Verheißung, aber du weißt nicht, wie du es ausgeben sollst. Das ist der Grund, weshalb du allein zu mir gekommen bist. Hast du nie gehungert? Ich bin der Mann, der diesen Hunger stillen kann. Hast du nie Verlangen gespürt? Ich kann Wünsche befriedigen, die du dir nicht einmal hast träumen lassen. Denk darüber nach, denn die Welt steht dir offen. Du kannst dir nehmen, was du willst. Lass dich von mir verführen. Greif zu mit deiner jungen, zögerlichen Hand und schwelge in der Macht.«
Er lehnte sich zurück und sah mich an.
»Was ist in den Fläschchen?«, fragte ich.
»In diesen hier?« Er drehte sich um und machte ein freudiges Gesicht wie ein Goldschmied in seiner Werkstatt. Mit seinen langen Fingern zog er behutsam eines heraus. »Dieses enthält Eisenhut.« Er hielt die hellblaue Phiole hoch. »Es versengt die Eingeweide und hinterlässt keine Spuren; ein nützliches Werkzeug. Und darin«, er zeigte auf eine braune Flasche mit gerillten Seiten, »ist Bilsenkraut, und in dem hier ist Eibenauszug. Jedes hat seine Verwendung, je nach Notwendigkeit.«
»In allen ist Gift?«, fragte ich.
»Oh ja, in allen. Und alle sind tödlich. Nur die Art des Todes ist unterschiedlich. Eines wird auch für Faustina und das Kind taugen … dieses hier vielleicht. Du brauchst dich mit der Sache nicht selbst zu belasten. Ich werde mich darum kümmern.«
Draußen ging der Tag zu Ende. Der Notar saß still da und sah mich starr an wie eine Eidechse auf einem Stein.
»Deshalb sollten wir zusammenarbeiten«, fuhr er fort, als ich nichts sagte. »Du und ich. Du als das öffentliche Antlitz der Macht, ich als das verborgene. Beide sind notwendig.«
»Nein«, sagte ich.
Er hob den Kopf. »Nein?«
»Deine Gifte stehen vor dir. Ich lasse dich allein, damit du deine Wahl treffen kannst. Entweder tust du es, oder du wirst für deine Verbrechen vor Gericht gestellt. Du weißt wohl, wie das Urteil ausfallen würde.«
Es folgte ein kurzes Schweigen.
»Du kannst die Hydra nicht töten«, hielt er mir streng entgegen. »Ich handle lediglich, wie die Natur es gebietet, und andere werden es mir nachtun, bis ans Ende der Zeit.«
»Vielleicht hast du recht. Aber auch ich handle, wie die Natur es gebietet. Und bis ans Ende der Zeit wird es Menschen geben, die dir widerstehen.«
Der Notar seufzte. Langsam nahm er eine seiner Phiolen, betrachtete sie, zog den Wachsstopfen heraus und leerte sie in ein kleines Glasgefäß.
»Diese Menge kann zehn Menschen töten«, sagte er und hob das Glas, wie um mir zuzuprosten. »Aber bedenke, ich bin dein Schatten … deine Rache macht dich zu meinesgleichen.«
Ich ließ mir mit der Antwort Zeit. Doch als ich sprach, war meine Stimme fest und klar.
»Nein, das stimmt nicht.«
SCHLUSSBEMERKUNG DES AUTORS

Diese Geschichte ist zwischen 355 und 361 n. Chr. angesiedelt, ein Jahrhundert vor dem Fall des Weströmischen Reiches. Zum Teil zeichnet es den Aufstieg des jungen Kaisersohnes Julian nach.
Schon oft war es so, dass der Sieger die Geschichte schreibt. Im Altertum war es die spätantike und mittelalterliche Kirche, die die Vergangenheit auslegte und zensierte. Was der Kirche missfiel, womit sie nicht einverstanden war, das unterdrückte sie. Vor der Erfindung der Druckerpresse hing das Überleben eines Buches vom handschriftlichen Kopieren ab, was langwierig war und große Sorgfalt erforderte, und es war die Kirche, die über das Schreiben, Kopieren und Bücherverbrennen bestimmte.
Die Kirche brandmarkte Julian als vom Glauben Abgefallenen, als Apostaten. Dieser Makel blieb an ihm haften, sodass man ihn noch heute vor allem als »Julian Apostata« kennt. Sein Onkel hingegen, Kaiser Constantin, der das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erhob, ist als Constantin der Große bekannt.
Umso überraschender ist es, dass viele von Julians Schriften überlebt haben. Nach wie vor können wir eine Verbindung zu diesem Mann herstellen – nicht nur über seine eigenen Worte, auch über die seiner Freunde und Feinde, denn er war eine Persönlichkeit, die heftige Kontroversen hervorrief. Aus diesen Texten erschließt sich uns das Bild eines intelligenten, nachdenklichen jungen Mannes, der im Zentrum der spätrömischen Macht gelebt und sie herausgefordert hat.
Vielleicht ist es sinnvoll, kurz auf die Begriffe »Cäsar« und »Augustus« einzugehen. Ursprünglich bezog »Cäsar« sich auf Julius Caesar, und »Augustus« war der Name, den Caesars Neffe und Adoptivsohn Oktavian annahm, als er der erste römische ›Kaiser‹ wurde. Im späten Römischen Reich waren diese Namen zu Amtstiteln geworden. Ein Augustus war ein Kaiser; ein Cäsar war ein Stellvertreter des Kaisers und dessen designierter Nachfolger. Und oft, aber nicht immer, waren beide Blutsverwandte.
Darüber hinaus erachtete man es zu verschiedenen Zeiten für zweckmäßig, das gewaltige Reich zwischen zwei oder mehr Kaisern aufzuteilen, von denen jeder einen Teil regierte – gewöhnlich trennte man in Ost und West. In der Spätzeit des Reiches gab es oft mehr als einen Kaiser, und jeder beherrschte ein anderes Gebiet. Da es dieser Geschichte dienlich schien, habe ich die komplizierteren Aspekte der spätrömischen Provinzverwaltung vereinfacht.
Читать дальше