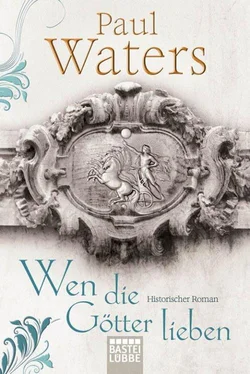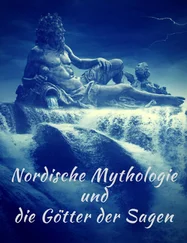»Die Germanen haben sie verschleppt«, erklärte Durano, der meinen Blick bemerkte. »Sie haben sie als Sklavin behalten, aber sie konnte fliehen. Ich habe sie im Wald gefunden.«
Ich fragte ihn, ob sie sein Eigentum sei.
»Nein, sie gehört mir nicht. Davon hat sie genug gehabt. Sie bleibt aus freien Stücken bei mir.« Er spuckte ins Gras und rieb den Speichel mit dem Fuß in den Boden. »Sie will nicht erzählen, was die Barbaren mit ihr angestellt haben. Aber nachts fährt sie noch immer erschrocken aus dem Schlaf hoch. Sie hasst die Germanen und würde eigenhändig gegen sie kämpfen, wenn sie könnte.«
Wir tranken von unserem Wein, und eine Zeit lang redeten wir über militärische Angelegenheiten: die bevorstehende Rheinüberquerung, Duranos Zenturie, den täglichen Lagerklatsch. Dann sagte er, als wäre ihm der Gedanke eben erst gekommen: »Du hast einen Freund bei der Reiterei. Er geht mit uns nach Germanien, und du bleibst hier.«
Ich blickte ihn an. »Stimmt. Du hast also gewusst, dass ich hier bin.«
Er lachte ein wenig verlegen, sodass seine Falten noch tiefer wurden. »Ja«, sagte er. »Aber die Zeit vergeht.«
Ich verstand. Er hatte schließlich seinen Stolz. Es wäre für ihn nicht infrage gekommen, mich ausfindig zu machen, nur um festzustellen, dass ich mich nicht mehr an ihn erinnerte oder erinnern wollte.
Ich spielte mit einem der Zweige im Feuer und sagte eine Zeit lang nichts.
Schließlich seufzte ich. »Ich war jung, Durano. Ich kannte mich selbst noch nicht. Aber so hätte ich dich nicht behandeln dürfen. Hättest du mir nicht so vieles beigebracht, wäre ich längst nicht mehr am Leben.«
Er deutete mit einer Geste an, dass ich zu viel Aufhebens davon machte. Doch ihm war anzusehen, dass er sich freute. Wenigstens war ich nicht mehr der gehemmte Junge, der nicht auszusprechen wagte, was er empfand. Ich streckte den Arm aus und berührte die Narbe an seiner Schläfe. Sie war nicht mehr ganz frisch, hatte aber noch eine dunkle Furche in der Mitte.
Er zog meine Hand herunter und hielt sie fest.
»Das war ein Germanenschwert«, sagte er. »Bei Straßburg. Es war dasselbe Schwert, durch das Romulus starb.«
»Das tut mir leid«, sagte ich.
Er ließ meine Hand los und zuckte die Achseln. »Es ist Krieg. Soldaten sterben.« Einen Augenblick später fragte er: »Warum kämpfst du nicht an der Seite deines Freundes?«
Ich holte tief Luft und blickte finster in den blassen Morgen. Marcellus und ich hatten oft darüber gesprochen, und es beschäftigte mich.
»Er ist bei der Reiterei, ich nicht.«
Aber Durano blickte mich weiterhin an, denn er wusste so gut wie ich, dass dies nicht die eigentliche Antwort war. Und so fügte ich hinzu: »Er ist ein besserer Reiter. Er würde ständig auf mich acht geben, anstatt auf sich selbst. Das hat er gesagt.«
Durano nickte bedächtig. »Dann tust du gut daran, hier zu bleiben. Jeder nach seinen Kräften. Die Männer erzählen Gutes über ihn. Er soll ein kühner Kämpfer sein, immer in der vordersten Reihe.«
»Das habe ich auch gehört.« Ein oder zwei Freunde, die glaubten, mir damit eine Freundlichkeit zu erweisen, hatten Marcellus’ Kühnheit in der Schlacht gelobt und mir genauestens berichtet, wie er sein Leben aufs Spiel setzte. Ich hatte mich daraufhin erkundigt, was sie von mir erwarteten, hätte es in Wirklichkeit aber lieber nicht erfahren.
Duranos nächste Frage kam wie ein Pfeil aus dem Nichts. »Liebst du ihn, Drusus?«
Ich drehte den Kopf, um zu sehen, ob er sich über mich lustig machte, aber sein schroffes Gesicht war ernst, und seine blauen Augen erwiderten meinen Blick ohne den geringsten Spott.
Deshalb antwortete ich: »Ja, ich liebe ihn. Aber ich kann ihm weder seine Kämpfe abnehmen noch ihn am Kämpfen hindern. Es gibt Dinge, da darf man nicht eingreifen, sonst zerbricht man etwas. Das weiß ich inzwischen.«
Er nickte und musterte mich schweigend. Er hatte nie viele Worte gemacht, wenn es um die wesentlichen Dinge ging. Das schätzte ich an ihm.
Nach einer Weile meinte er: »Es liegt bei den Göttern, und das ist gut so.«
Dann richtete er sich auf und streckte sich, als hätte er geschlafen, breitete die sonnengebräunten Arme mit ihren harten Muskeln und den alten Schwertwunden aus.
Ringsumher kam Bewegung in das Lager. Wir aßen unser Brot auf, wischten die Käsekrümel vom Teller und tranken die Becher leer. Kurz darauf verabschiedete ich mich und versprach, noch bis zum anderen Ufer mitzugehen, wo das restliche Heer sich mit der Vorhut vereinen sollte.
Nach einer kurzen Umarmung hielt er mich noch einmal auf und sagte, er wolle mich um einen Gefallen bitten.
»Nur zu«, ermunterte ich ihn.
Er deutete mit dem Kopf auf das Mädchen, das in der Nähe saß und nähte. »Sie hat gut für mich gesorgt, für wenig Lohn. Sie hat von Männern genug Leid erfahren. Finde einen guten Platz für sie, falls ich nicht zurückkehre.«
Ich versprach es ihm und machte ein Zeichen gegen böse Omen, was ihm ein Lachen entlockte. Dann trennten wir uns.
Bevor ich um die Ecke bog, blickte ich über die Schulter. Durano war bereits gegangen, aber das Mädchen saß noch auf dem Schemel vor dem Zelt, die Näharbeit – Duranos roter Mantel – im Schoß. Doch ihre Augen waren nicht auf die Arbeit gerichtet. Sie blickte mir nach, kühl und kühn und abschätzend.
Zwei Tage später überquerte die Vorhut den Rhein.
Ich stand neben Oribasius am Westufer und sah zu, als vor uns die Soldaten, ein Mann hinter dem anderen, über die Bootsbrücke zogen, ohne Gleichschritt, um den Steg nicht zu sehr ins Schwanken zu bringen. Am anderen Ufer, auf der Wiese am Waldrand, stellten sich die ersten Soldaten zur Verteidigungslinie auf. Vorausgeschickte Kundschafter hatten bereits gemeldet, das Gebiet hinter dem Brückenkopf sei frei. Doch eine Flussüberquerung ist eine gefährliche Zeitspanne, und die Männer waren unruhig wegen der endlosen Wälder Germaniens, in denen allerhand Schrecken lauerten.
Bis Mittag waren alle drüben. Dann trat eine Pause ein, als die Truppenteile sich nach Marschordnung zusammenfanden.
Ich hatte nach Marcellus Ausschau gehalten und entdeckte ihn jetzt. Gut aussehend und kerzengerade ritt er auf seiner braunen Stute an der Marschkolonne entlang zu seiner Schwadron. Der junge Rufus war bei ihm und redete voll froher Erwartung auf ihn ein, wobei er auf dieses und jenes aufmerksam machte. Ich schmunzelte. Dabei hätte ich eifersüchtig werden können, denn der Junge war verliebt; es war ihm nur selbst nicht bewusst. Während der letzten Tage, wann immer ich ihm begegnet war, hatte er nur noch von dem Feldzug gesprochen, und von Marcellus, der bei ihm sein würde. Eines Abends im Bett hatte ich Marcellus damit aufgezogen. Doch Rufus hatte bei seiner arglosen Unbedarftheit nichts an sich, das misstrauisch machen konnte.
Vorn gab es Bewegung. Severus, der an der Spitze des Zuges im Sattel saß, hob den Arm und gab das Zeichen; dann bliesen die Trompeter zum Abmarsch.
Ich schaute zu Julian. Er stand ein wenig abseits und spähte stirnrunzelnd zum anderen Ufer, wo das Heer nach und nach unter dem Blätterdach des Waldes verschwand. Es ging ihm gegen den Strich, dass er nicht dabei war. Er hätte die Männer selbst angeführt, hätte Severus ihn nicht davon abgebracht, indem er ihm freiheraus vorgehalten hatte, welche Errungenschaften er opferte, wenn er fiele.
Das Gebiet auf der anderen Seite wurde von Suomar beherrscht, einem alemannischen Gaukönig. Als sich der Bau der Bootsbrücke dem Abschluss näherte, hatte er eingesehen, dass wir es ernst meinten, hatte sich bei Julian eingefunden und um einen Friedensvertrag gebeten, dem Julian unter der Bedingung zustimmte, dass seinem Heer freies Geleit gewährt und die römischen Gefangenen, die als Sklaven gehalten wurden, zurückgegeben würden. Suomar erklärte sich dazu bereit, und der Vertrag wurde geschlossen. Danach hatte er uns wohlwollend zwei seiner jungen Krieger als Kundschafter angeboten, da sie den pfadlosen Wald kannten und uns führen konnten.
Читать дальше