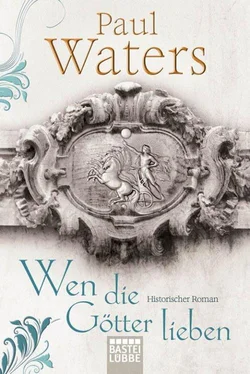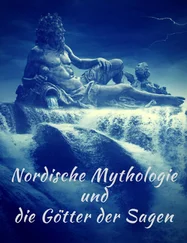Seit wir von der Maas zurückgekehrt waren, hatte Marcellus sich große Mühe gegeben, die Reiter in Form zu bringen. Er war mit ihnen vor die Stadt geritten, wo sie üben konnten, über Gräben, Mauern und Wälle zu springen, sodass Pferd und Reiter einander kennenlernten – auch die Reiter untereinander, damit sie eine Einheit bildeten. Marcellus war beliebt, und Rufus wich ihm wie ein zutraulicher Hund nicht von der Seite. Er war ein gutmütiger, hübscher junger Mann von achtzehn Jahren mit schwarzen Haaren, frischem Gesicht und auffallend wachen Augen. Sein Vater war Pferdehändler in Marseille, und Rufus war mit Pferden aufgewachsen. Für sein Alter sah er jung aus und wurde deswegen geneckt, aber er war der geborene Reiter.
»Na, was hältst du von ihr, Drusus?«, fragte er.
Ich machte ihm Komplimente wegen seiner Stute und ließ mir von ihm erzählen, wie er den ganzen Morgen dem Pfleger zur Hand gegangen war. Es war unmöglich, ihn nicht zu mögen. Sein zärtlicher Umgang mit Pferden war rührend und strahlte eine Unschuld aus, die ein Mann gewöhnlich zu verbergen sucht. Ich konnte verstehen, warum Marcellus ihn unter seine Fittiche genommen hatte.
Gaudentius und sein ungeschicktes Spionieren ging mir nicht aus dem Kopf, und bei meiner nächsten Begegnung mit Eutherius erwähnte ich, was vorgefallen war.
Ich erzählte es leichthin und rechnete damit, dass er es lachend abtat, da er an jede Art von Intrige gewöhnt war und Florentius für einen Stümper hielt. Stattdessen aber blickte er mich scharf an und bat mich, ihm Gaudentius zu beschreiben, da er ihm noch nicht vorgestellt worden war.
Danach nickte er und sagte: »Ja, ich kenne ihn. Er ist einer von Constantius’ Agenten.«
»Dann handelt er gar nicht in Florentius’ Auftrag?«
»Constantius’ Agenten nehmen von anderen keine Aufträge an, schon gar nicht von jemandem, der so weit unter dem Kaiser steht.« Er nahm eine Feige aus einer Schale mit Trockenfrüchten und beäugte sie. »Er wird jemandem bei Hofe berichten, dem Oberkämmerer vermutlich.«
»Dabei wirkt er eigentlich harmlos, sogar ein bisschen dümmlich.«
»Ein unfähiger Bauernlümmel ist er«, sagte Eutherius, »und es war sicherlich beabsichtigt, dass er bemerkt wird. Doch seinetwegen sind schon Männer hingerichtet worden. Du solltest seine Fähigkeit, Unheil anzurichten, nicht unterschätzen.«
Den ganzen Winter arbeitete Julian schon an seiner Strategie, beriet sich mit den Befehlshabern und Kundschaftern, brütete über Karten der Grenzgebiete und prüfte sämtliche Wege, Ebenen und Flussübergänge. Bei seinem ersten Feldzug, als Barbaren noch über ganz Gallien verbreitet waren, hatte er sie lediglich zurückgetrieben, wenn er auf sie stieß, wie ein Mann, der die Lecks in einer Zisterne stopfen will. Jetzt aber hatte er einen festen Plan: Er wollte einen dauerhaften Frieden herbeiführen.
Es habe eine Zeit gegeben, sagte er, wo die Grenze von der Rheinmündung bis Straßburg und zum Gebirge Rätiens ein wehrhafter Schutz gewesen sei. Doch inzwischen zeigten wir so viel Schwäche, dass die Alemannen und Franken und andere umherziehende Stämme sich auf römischem Gebiet niedergelassen hätten, und jetzt hätten sie es schon so lange besetzt, dass sie es als ihr Eigentum betrachteten.
Anfangs noch dankbar wie Bettler, denen gegeben wird, hätten diese Siedler versprochen, die römischen Gesetze zu achten und friedlich zu leben. Doch die Germanen seien von Natur aus unbeugsam und hätten nicht gelernt, ihren Stolz durch vernünftige Überlegung zu zügeln. Als ihnen klar geworden sei, dass sie ihre wehrlosen Nachbarn ungestraft überfallen konnten, gaben sie die Feldarbeit auf und widmeten sich der Räuberei. Sie stahlen Getreide, brannten Dörfer nieder, verschleppten Bürger und machten sie zu ihren Sklaven. Nachdem solches Verhalten so lange hingenommen worden war, sahen die Barbaren es als ihr Recht an.
»Aber warum lassen wir das zu?«, fragte Julian. »Fürchten wir sie? Oder haben wir kein Vertrauen mehr in uns selbst?« Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder der großen Karte auf dem Tisch zu. »Wir müssen die Grenze wiederherstellen. Wir müssen die Germanen über den Rhein zurücktreiben, sonst werden sie eines Tages, wenn wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, in Scharen über die Bergpässe in die Ebenen Galliens kommen und Spanien, Italien und Rom einnehmen.«
Die Quästoren und Tribunen am Tisch wechselten verstohlene Blicke. Der Cäsar pflegte bei solchen Dingen zu übertreiben. Aber zu behaupten, Rom selbst könnte fallen – das war doch allzu weit hergeholt.
Julian blieb auf die Karte konzentriert; er sah das vielsagende Lächeln der Männer nicht. »Das dürfen wir ihnen nicht erlauben«, schloss er und tippte auf die gekrümmte Linie des Rheins. »Hier müssen wir sie aufhalten!«
Ungeduldig wartete er auf das Ende des langen nördlichen Winters. Als sich an den Pflaumenbäumen im Hof die ersten Blüten zeigten und am Flussufer die gelben Krokusse zum Vorschein kamen, befahl er, sich marschbereit zu machen. Da erst kam Florentius zu ihm und teilte mit, dass der Nachschub aus Aquitanien nicht eingetroffen war.
»Wo ist er denn abgeblieben?«, verlangte Julian zu wissen. »Du kanntest meine Pläne. Du hattest den ganzen Winter Zeit für die Vorbereitungen.«
Florentius lächelte säuerlich und erwiderte, als spräche er mit einem Dummkopf, dass der Verlauf solcher Transporte schwer vorherzubestimmen sei, besonders während des Winters. Darüber hinaus habe es Krankheitsfälle unter den zuständigen Beamten gegeben, was unvermeidliche Verzögerungen zur Folge gehabt habe. Man habe Bestellungen genehmigen und überprüfen sowie zur Abwägung an vorgesetzte Stellen weiterleiten müssen. Ein Mann in so hoher Position wie der Cäsar verstünde das doch sicherlich? So redete er klagend und monoton und ließ sich lang und breit über die Schwierigkeiten aus.
Julian starrte ihn an, und sein Mund wurde immer schmaler.
Schließlich fiel er ihm ins Wort: »Wann bekomme ich den Nachschub?«
»Vielleicht in einem Monat, vielleicht später. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen.«
»Die Lieferung wird aber irgendwo sein, nicht wahr?«
»Selbstverständlich.«
»Dann schicke einen deiner Leute aus, um sie zu finden. Ist das möglich, Präfekt? Oder muss ich es selbst tun?«
»Das wird nicht nötig sein«, begann Florentius aalglatt, doch Julian unterbrach ihn. »Gut. Dann erwarte ich deine Meldung. Und jetzt haben wir beide zu tun, nicht wahr?«
Damit ließ er Florentius stehen und verließ den Raum, vielleicht, weil er sonst doch noch die Beherrschung verloren hätte.
Aber ich war noch da, und so wandte der Präfekt sich mit flammendem Blick mir zu. Der Cäsar müsse begreifen, sagte er kalt, dass man sich an die vorgeschriebenen Abläufe zu halten habe; er hätte sich diese Dinge eben ein Jahr vorher oder noch eher überlegen müssen. Wenn er jetzt in Schwierigkeiten sei, habe er das nur seinem draufgängerischen Temperament zuzuschreiben.
Wenn Florentius glaubte, ich sei auf seiner Seite, hatte er sich getäuscht. Ich hörte ihn zu Ende an und erwiderte: »Unsere Feinde haben es noch nicht gelernt, sich nach dem Gutdünken der Verwaltungsbeamten zu richten.« Dann entschuldigte ich mich und ging.
Die Zeit verstrich. Aus Tagen wurden Wochen, und noch immer war der Nachschub nicht eingetroffen.
Julian beklagte, dadurch den Vorteil der Überraschung zu verlieren. Jeder weitere Tag werde das Leben römischer Bürger kosten. Er wartete einen Monat lang; dann sagte er eines Morgens: »Begleite mich ins Lager, Drusus. Ich möchte die Vorräte inspizieren.«
Wir ritten zum Kastell, und gemeinsam mit dem Quartiermeister blickten wir in die dunklen Kammern und auf die Reste der Gerstenration.
Julian nahm eine Handvoll auf und ließ die Körner durch die Finger rinnen. »Das reicht noch für zwanzig Tage«, stellte er fest. Er befahl dem Quartiermeister, die Gerste verbacken zu lassen. Dann wandte er sich an mich und bemerkte mit leisem Lächeln: »Ich bin gespannt, wie lange der Präfekt warten wird, bevor er zu mir kommt.«
Читать дальше