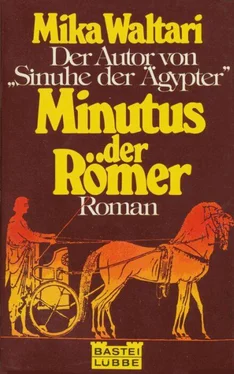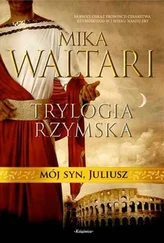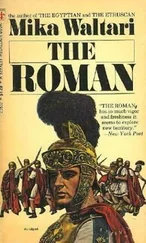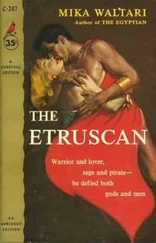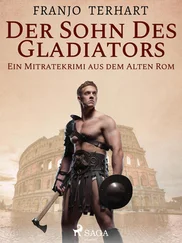Ich verließ das Haus durch die hintere Tür und nahm in der Küche den Segen der verschwitzten Sklaven entgegen, die ich zu essen und zu trinken bat, soviel sie vermochten, da keine Gäste mehr zu erwarten waren, sondern das Haus sich schon zu leeren begann. Draußen bei der Pforte sah ich pflichtgetreu nach den beinahe schon ganz niedergebrannten Fackeln und dachte wehmütig, daß dies nun vielleicht der größte und festlichste Tag meines Lebens gewesen sei. Das Leben selbst ist ja eine Fackel, die anfangs hell brennt und zuletzt in Rauch und Qualm verlischt.
Da trat mir plötzlich aus dem Schatten der Mauer eine weibliche Gestalt entgegen, die in einen braunen Mantel gehüllt war. »Minutus, Minutus«, flüsterte sie vorsichtig. »Ich will dir Glück wünschen, und diese Kuchen habe ich selbst für dich gebacken. Ich wollte sie den Sklaven übergeben, aber das Schicksal war mir günstig und ich traf dich selbst.«
Erschrocken erkannte ich Claudia, vor der Tante Laelia mich gewarnt hatte. Zugleich aber schmeichelte es mir, daß dieses sonderbare Mädchen sich nach meinem Festtag erkundigt hatte, um mir Glück wünschen zu können. Und als ich ihre dichten schwarzen Brauen, ihren großen Mund und ihre sonnengebräunte Haut sah, da durchströmte mich plötzlich eine tiefe Freude. Sie war so ganz anders als diese säuerlichen alten Frauen, die sich in unserem Haus versammelt hatten. Claudia war lebendig und natürlich und verstellte sich nicht. Und sie war meine Freundin.
Scheu legte sie mir eine Hand an die Wange und war lange nicht so übermütig und selbstsicher wie bei unserem ersten Zusammentreffen. »Minutus«, flüsterte sie. »Du hast gewiß Schlimmes über mich gehört, aber ich bin nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Seit ich dir begegnet bin, mag ich überhaupt nur noch gute Gedanken denken, und auf diese Weise hast du mir wirklich Glück gebracht.«
Wir gingen nebeneinander her. Claudia zog mir die Toga am Hals zurecht, und dann aßen wir zusammen einen ihrer Kuchen, indem wir abwechselnd davon abbissen, ganz wie wir es damals in der Bibliothek mit dem Käse gemacht hatten. Der Kuchen war mit Honig und Kümmel gewürzt, und Claudia erzählte mir, daß sie selbst den Honig und den Kümmel gesammelt und in einer alten Handmühle die Weizenkörner gemahlen hatte.
Diesmal nahm sie beim Gehen nicht meinen Arm, sondern wich jeder Berührung mit mir scheu aus. Von meiner neuen Mannheit ganz erfüllt, ergriff ich selbst ihren Arm und führte sie zwischen den Menschengruppen auf der Straße hindurch. Sie seufzte glücklich, und ich faßte so viel Vertrauen zu ihr, daß ich ihr von meinem Gelübde berichtete und ihr sagte, daß ich nun mit meiner Opfergabe in einer Silberbüchse auf dem Weg zum Tempel der Mondgöttin war.
»Huh!« machte sie erschrocken. »Dieser Tempel hat einen schlechten Ruf. Nachts werden dort hinter verschlossenen Türen sittenlose Mysterien gefeiert. Wie gut, daß ich vor deinem Haus stand und auf dich wartete. Wenn du allein gegangen wärst, hättest du mehr dort drinnen gelassen als nur deine Opfergabe.«
Und nach einer kleinen Weile fuhr sie fort: »Ich selbst mag mir nicht einmal mehr die staatlichen Opfer ansehen. Die Götter sind nur Stein und Holz. Der Narr auf dem Palatin erweckt die alten Zeremonien wieder zum Leben, nur um das Volk noch fester mit den alten Fesseln zu binden. Ich habe meinen eigenen heiligen Baum und einen klaren Opferquell. Wenn mir traurig zumute ist, gehe ich hinauf zum Orakel auf dem Vatikanischen Hügel und betrachte den Vogelflug.«
»Du sprichst wie mein Vater«, sagte ich. »Der will nicht einmal, daß mir ein Seher aus einer Leber weissagt. Aber es gibt geheimnisvolle Mächte und Zauberei, das geben sogar vernünftige Menschen zu. Daher will ich mein Gelübde lieber erfüllen.«
Indessen waren wir vor dem tief in den Boden eingesunkenen Tempel angekommen. Zu meiner Erleichterung stand die Tür weit offen, und drinnen brannten einige kleine Öllampen, aber es war niemand zu sehen. Ich hängte meine Silberbüchse zwischen den anderen Tempelgaben auf. Wahrscheinlich hätte ich die Glocke läuten müssen, um die Priesterin zu rufen, aber ich hatte, offen gestanden, Angst vor ihr und wollte gerade in diesem Augenblick ihr leichenblasses Gesicht nicht sehen. Schnell tauchte ich die Fingerspitzen in das heilige Öl und strich es auf das schwarze steinerne Ei. Claudia lächelte belustigt und legte einen Kuchen als Geschenk auf den leeren Schemel der Priesterin. Dann liefen wir aus dem Tempel wie zwei mutwillige Kinder.
Draußen küßten wir uns. Claudia hielt mein Gesicht zwischen beiden Händen und fragte eifersüchtig: »Hat dein Vater dich schon einer versprochen, oder hat man dir nur ein paar kleine Mädchen gezeigt, unter denen du dir eins aussuchen sollst? Das ist ja an einem Tag wie diesem der Brauch.«
Ich hatte den wahren Grund nicht vermutet, warum Tante Laelias alte Freundinnen einige kleine Mädchen mitgebracht hatten, die mich mit dem Finger im Mund anstarrten, und hatte angenommen, sie seien nur gekommen, um Backwerk und Süßigkeiten zu naschen. Daher sagte ich nun erschrocken: »Nein, nein, mein Vater hat nicht die Absicht, mich schon mit irgend jemandem zu verheiraten.«
»Ach, wenn ich nur meine Zunge im Zaum halten und dir in ruhigen, wohlgesetzten Worten sagen könnte, was ich denke«, sagte Claudia traurig. »Binde dich nur nicht zu früh, das bringt nichts als Unheil. Es gibt ohnehin schon genug Ehebrecher in Rom. Der Altersunterschied zwischen uns beiden kommt dir jetzt gewiß sehr groß vor, denn ich bin ja fünf Jahre älter als du, aber mit den Jahren und wenn du erst einmal deinen Waffendienst als Kriegstribun geleistet hast, wird dieser Unterschied immer geringer werden. Du hast einen Kuchen gegessen, den ich gebacken habe, und mich aus freiem Willen auf den Mund geküßt. Ich habe darum zwar keine Rechte auf dich, aber ich nehme es als ein Zeichen dafür, daß du mich nicht ganz unausstehlich findest, und daher bitte ich dich, bisweilen an mich zu denken und dich an keine andere zu binden, ehe du nicht mit mir darüber gesprochen hast.«
Ich dachte im Traum nicht daran, mich zu vermählen, und daher fand ich ihre Bitte ganz vernünftig. Ich küßte sie ja gerne, und es wurde mir so warm, wenn ich sie im Arm hielt. Daher sagte ich: »Das verspreche ich dir gern, nur darfst du nicht darauf bestehen, mir ständig nachzulaufen und überall mit dabeisein zu wollen. Außerdem habe ich mir nie etwas aus den albernen Mädchen in meinem eigenen Alter gemacht. Dich mag ich, weil du reifer bist und Bücher liest. Ich kann mich auch nicht erinnern, daß die Dichter in ihren Liebesliedern Hochzeitszeremonien beschreiben. Nein, sie schildern die Liebe als frei und ungebunden. Kein Wort von Heim und Herd, sondern nichts als Mondschein und Rosenduft.«
Claudia wurde unruhig und rückte ein wenig von mir ab. »Du weißt nicht, wovon du redest«, sagte sie tadelnd. »Warum sollte ich nicht an den feuerroten Schleier, den safrangelben Mantel und den Gürtel mit den zwei Knoten denken dürfen! Es ist der innigste Wunsch jeder wirklichen Frau, wenn sie einem Mann die Wangen streichelt und ihn auf den Mund küßt.«
Ihre Einwände reizten mich nur dazu auf, sie noch einmal fest in die Arme zu schließen, um ihren widerstrebenden Mund und ihren warmen Hals zu küssen. Aber Claudia riß sich los, gab mir eine schallende Ohrfeige und brach in Tränen aus, die sie sich mit der Hand fortwischte.
»Ich glaubte, du dächtest anders von mir«, sagte sie schluchzend. »Das ist nun also der Dank dafür, daß ich mir Zwang antat und nur Gutes von dir dachte. Du willst nichts anderes, als mich dort drüben bei der Mauer auf den Rücken werfen und mir die Knie auseinanderzwängen, um deine neugierigen Gelüste an mir zu stillen. Nein, so ein Mädchen bin ich nicht!«
Ihre Tränen ernüchterten mich, und ich sagte verdrossen: »Du bist stark genug, um dich zu wehren, und ich weiß nicht einmal, ob ich das, was du meinst, mit dir tun könnte. Ich habe nie mit Sklavinnen gespielt, und meine Amme hat mich auch nicht verführt. Du brauchst also nicht zu flennen, denn du bist in diesen Dingen bestimmt erfahrener als ich.«
Читать дальше