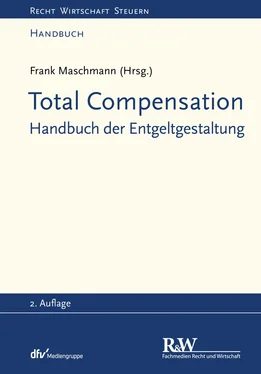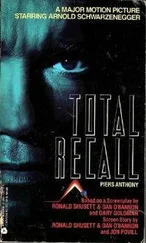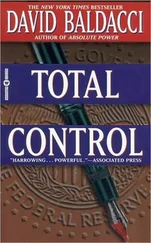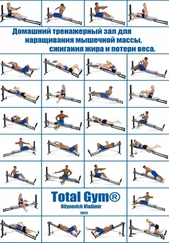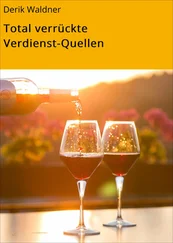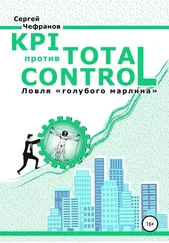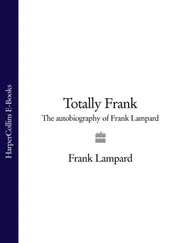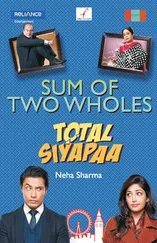28
Bei der Arbeitsbereitschaftist der Aufenthaltsort des Arbeitnehmers auf den Arbeitsplatz beschränkt. An diesem muss er „wachsam“ anwesend sein, sodass er bei Bedarf sofort ohne weitere Anweisung in die Vollarbeit wechseln kann.114 Beispiele hierfür sind die Wartezeiten von Rettungssanitätern zwischen den einzelnen Einsätzen sowie das Warten von Verkäufern auf die nächsten Kunden.115 Die Arbeitsbereitschaft stellt unstreitig mindestlohnpflichtige Arbeitszeit dar. Für sie ist stets der volle Mindestlohn zu gewähren,116 da das MiLoG nicht nach der Intensität der Arbeitsleistung differenziert, § 1 Abs. 2 MiLoG. Abweichende Vereinbarungen sind unwirksam, § 3 Satz 1 MiLoG (zu den Rechtsfolgen s. Rn. 66).
29
Rufbereitschaftliegt vor, wenn der Arbeitnehmer sich an einem, gegenüber dem Arbeitgeber anzuzeigenden, erreichbaren Ort seiner eigenen Wahl bereithält, um bei Abruf die Arbeit alsbald aufzunehmen.117 Dabei erbringt er nicht die eigentlich vertraglich geschuldete, sondern eine zusätzliche Leistung.118 Diese ist nicht mit dem Mindestlohn zu entlohnen.119 Die mindestlohnrelevante Arbeitszeit liegt erst ab Arbeitsaufnahme vor,120 die jedoch bereits mit der Fahrt zur Arbeitsstätte beginnt.
30
Umstritten ist die mindestlohnrechtliche Behandlung des Bereitschaftsdienstes(i.e.S.). Dieser steht zwischen Arbeits- und Rufbereitschaft. Er liegt vor, wenn der Arbeitgeber einen bestimmten Aufenthaltsort außerhalb des Arbeitsplatzes vorschreibt, an dem der Arbeitnehmer sich aufzuhalten hat, um bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen.121 Bereitschaftsdienste sind richtigerweise mit dem Mindestlohn zu vergüten, da die Pflicht des Arbeitnehmers an einem ihm vorgeschriebenen Ort zu verweilen, eine vergütungspflichtige Arbeitsleistung darstellt, sodass mindestlohnrelevante Arbeitszeit vorliegt.122 § 1 Abs. 2 MiLoG stellt insoweit nicht auf Qualität oder Intensität der Tätigkeit ab.123
d) Pausen- und Ruhezeiten
31
Ruhepausenunterfallen grundsätzlich nicht der mindestlohnpflichtigen Arbeitszeit.124 Sie liegen vor, wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer Vereinbarung seine Arbeitsleistung für einen ihm im Vorhinein bekannten unwiderruflich festgelegten Zeitraum unterbricht.125 Etwas anderes muss jedoch dann gelten, wenn der Arbeitnehmer nicht frei entscheiden kann, wo und wie er die Pausenzeit verbringen will oder sich sogar auf Abruf für Arbeit bereitzuhalten hat.126 Für kurzfristige Arbeitsunterbrechungenentfällt die Mindestlohnpflicht dagegen nicht.127 Die Grenze hierfür ist einzelfallbezogen zu bestimmen und darf für die jeweilige Tätigkeit nicht als beachtlich angesehen werden (unproblematisch: „Verschnaufpausen“ von max. 3 Minuten;128 i.d.R. beachtlich: 15-minütige Unterbrechungen, vgl. § 4 Satz 2 ArbZG). Zeiten, in denen die Arbeit aus technischen oder betriebsorganisatorischen Gründen nicht stattfinden kann (sog. Betriebspausen), sind mit dem Mindestlohn zu vergüten, da der Arbeitnehmer in diesen über seine Zeit nicht frei disponieren kann.129
e) Reise-, Wege- und Umkleidezeiten
32
Bei Reisezeiten, die zur Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmersgehören, konkretisiert der Arbeitgeber die Arbeitsleistung, indem er den Arbeitnehmer anweist, eine Dienstreise durchzuführen.130 Es liegt Vollarbeit vor, die mit dem Mindestlohnstundensatz zu vergüten ist, § 1 Abs. 2 MiLoG. Dies gilt regelmäßig auch für Mitarbeiter im Außendienst, die ihre vertraglich geschuldete Arbeitsleistung nicht ohne Reisetätigkeit erfüllen können, sodass diese als Bestandteil der vergütungspflichtigen Haupttätigkeit anzusehen ist.131
33
Bei außerhalb der normalen Arbeitszeitliegenden Reisezeiten besteht ein Mindestlohnanspruch des Arbeitnehmers dagegen nur, soweit Arbeitsleistungen während der Reise erbracht werden.132 Beantwortet der Arbeitnehmer beispielsweise während einer angeordneten Zugfahrt dienstliche E-Mails, bearbeitet er Akten oder führt er zur Arbeit gehörende Telefonate, liegt mindestlohnrelevante Arbeitszeit vor. Verbringt er die Reise dagegen rein mit Tätigkeiten, die lediglich seiner privaten Lebensführung zuzuordnen sind, besteht hierfür kein Anspruch auf Zahlung des Mindestlohns.133 Ein Rechtssatz, dass Reisezeiten stets zu vergüten sind, existiert nicht.134 Zeiten der Übernachtung sind ebenfalls nicht mindestlohnpflichtig, da sie nicht ausschließlich fremdnützig sind.135 Wird der Arbeitnehmer angewiesen, selbst einen Pkw zu steuern, besteht Mindestlohnpflicht, da ihm eine vergütungspflichtige Tätigkeit abverlangt wird.136
34
Reisezeiten wurden bisher oft geringer als die normale Arbeitszeit vergütet.137 In Tarifverträgen konnte sogar Nichtzahlung angeordnet werden, vgl. § 44 Abs. 2 Satz 1 TVöD.138 Derartige Vereinbarungen sind nunmehr unwirksam, soweit für vergütungspflichtige Wegezeiten nicht zumindest der Mindestlohn je Zeitstunde entrichtet wird, § 3 Satz 1 MiLoG.139 Damit sind Regelungen über pauschale Abgeltungen oder die Nichtzahlung für Reisezeitenjedoch nicht per se ausgeschlossen. Erhält der Arbeitnehmer ein verstetigtes Monatseinkommen, muss dieses lediglich, auf den Kalendermonat bezogen, den vollen Mindestlohnstundensatz für jede geleistete Arbeitsstunde gewähren. Liegt der Gesamtlohn hinreichend über der nach dem MiLoG zu entrichtenden Vergütung, können Reisezeiten weiterhin, soweit die Differenz zwischen gewährtem und mindestlohnpflichtigem Lohn nicht überschritten wird, geringer oder sogar überhaupt nicht entlohnt werden.
35
Die Zeitspanne, die der Arbeitnehmer benötigt, um zum Arbeitsplatz zu gelangen und von diesem zurückzukehren (sog. Wegezeit), ist grundsätzlich der privaten Lebensführung zuzuordnen,140 sodass mindestlohnpflichtige Arbeitszeit nicht vorliegt. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Arbeitnehmer angewiesen wird, sich direkt von der Wohnung oder aus dem Betrieb zu einer auswärtigen Arbeitsstelle zu begeben (z.B. Anreise eines Bauarbeiters zu wechselnden Baustellen).141 In derartigen Fällen besteht ein Anspruch auf Mindestlohnzahlung für die Anreise. Umkleidezeitengehören dann zur mindestlohnpflichtigen Arbeitszeit, wenn das Ankleiden einer vorgeschriebenen Arbeitskleidung nur im Betrieb erfolgen kann oder diese derartig auffällig ist, dass ein Tragen im öffentlichen Raum unzumutbar ist.142
f) Zeiten der Nichtarbeit
36
Inwieweit der Arbeitnehmer für Zeiten der Nichtarbeit – also bei Krankheit, an Feiertagen, im Urlauboder bei Annahmeverzug des Arbeitgebers– den Mindestlohn beanspruchen kann, wird im MiLoG nicht explizit geregelt. Einige Stimmen in der Literatur lehnen dies kategorisch ab, da für das Entstehen des Mindestlohnanspruches die Arbeitsleistung tatsächlich erbracht worden sein müsste – heißt es doch „Arbeitsleistung erbracht“ in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MiLoG und „geleistete Arbeitsstunden“ in § 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG.143 Ein solches Ergebnis überzeugt für das AEntG,144 nicht jedoch für das Mindestlohngesetz.145 Letzteres erlegt allen Arbeitgebern mit Sitz im In- oder Ausland die Pflicht auf, ihren im Inland beschäftigten Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt zumindest in Höhe des Mindestlohns zu bezahlen, § 20 MiLoG. Sind diese aufgrund der Regelungen des BUrlG, EfzG oder des § 615 BGB von der Pflicht zur Erfüllung der Arbeitsleitung befreit, besteht die Lohnzahlungspflicht weiterhin fort (sog. Entgeltfortzahlungsprinzip). Dem Arbeitnehmer steht das Entgelt zu, das er auch ohne den Arbeitsausfall bekommen hätte. Er hat folglich grundsätzlich auch für Zeiten der Nichtarbeiteinen Anspruch auf den Mindestlohn.146 Dem steht nicht entgegen, dass sich das Mindestlohngesetz an dem Vorliegen vergütungspflichtiger Arbeitszeit orientiert. Denn die gesetzlichen Regelungen für Nichtarbeit ordnen ja gerade trotz Nichtleistung des Arbeitnehmers die Aufrechterhaltung der Lohnzahlungspflicht an, ohne dass dieser „im arbeitstechnischen Sinne aktiv“ geworden sein müsste.147
Читать дальше