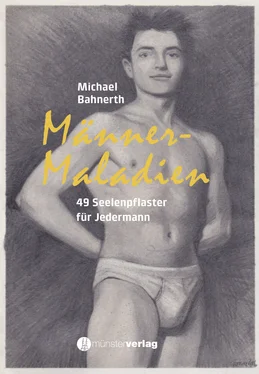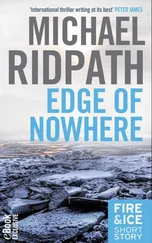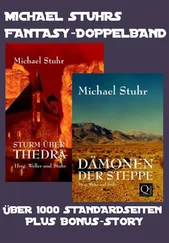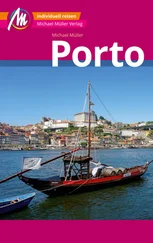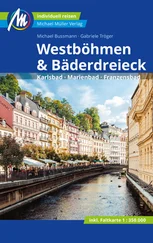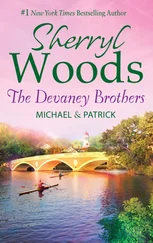Und manchmal sitze ich zu Hause auf einem Sessel und denke, was für eine verdammte Scheisse das ist, dass die inneren Schätze noch schwerer zu heben sind als die weltlichen, und ich hadere ein wenig mit dem Leben und seinem Sinn und frage mich, was geworden wäre, wenn ich als junger Mann einen Schatz gefunden hätte. Wahrscheinlich würde ich auf einem Sessel sitzen und mir dieselben Gedanken machen.
Ich sitze jetzt mit dem Rücken zum Fenster bei meinem Therapeuten. Ich vermute, das liegt daran, dass mich während der letzten Sitzung zwei kopulierende Tauben mehr interessiert haben als das Paradox der Leichtigkeit im menschlichen Sein, das so geht: Weil die Aufrechterhaltung der Leichtigkeit mit zunehmender Dauer immer mehr Verdrängung bedarf, wird das Verdrängte zu einer Last, die die Leichtigkeit erdrückt. Das ist natürlich eine traurige Unzulänglichkeit am Seinsmodell des Menschen.
«Michael, haben Sie Ihr individuelles Leichtigkeitsprinzip hinterfragt?», fragt mein Therapeut.
«Nein.»
«Michael, es wäre hilfreich, wenn Sie sich auf die Therapie einlassen würden.»
«Schon. Aber es ist doch so: Wenn der Weg der Leichtigkeit nur über die tägliche Auseinandersetzung mit der Schwierigkeit möglich ist, dann bleibt Leichtigkeit doch immer etwas, das in der Zukunft liegt.»
«Entschuldigen Sie, Michael, langsam habe ich den Eindruck, dass Sie in Klugscheisserei flüchten, um Ihre eigentlichen Probleme zu verdrängen.»
«Sie meinen meine Fähigkeit des Verdrängens, meine Weigerung, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, wenn sie unangenehm sind?»
«Genau, Ihre Weigerung, erwachsen zu werden. Michael, Sie sind bald 50.»
«Gibt es einen vernünftigen Grund, erwachsen zu werden?»
«Das Finden von innerer Harmonie, Michael, das Anpassen der Träume an die äussere Wirklichkeit.»
«Meinen Sie, das ist der Pfad hin zum glücklichen Leben?»
«Es gibt natürlich keine Garantien, Michael.»
«Eben.»
«Michael, ich frage mich gerade, ob Sie untherapierbar sind.»
«Wieso?»
Ich war unlängst auf Mallorca, Puerto Portals, Hotel Punta Negra, Zimmer 311, traumhafte Terrasse, ein paar durchlässige Pinien, zwischen denen das Meer hindurchdrängte, Meeresrauschen bei offener Balkontür, Sonnenaufgänge, die das Meer vergoldeten, grosses Kino, 10 Billion Dollar View und so weiter. Ich sass da, erlöst vom Diktum der Zeit, und verlor mich ein klein wenig, leider nur, im ewigen Kontinuum, dann spuckte es mich wieder aus in die Vergänglichkeit, und ich dachte, welch unrühmlichen Umgang die Schweiz mit ihrer Zeit pflegt und wie wenig «tranquillo» sie ist. Dass wir kein Savoir-vivre haben und dass für das Menschsein so elementaren Daseinsformen wie Musse und Müssiggang der Geruch von Arbeitsscheue und Asozialität anhaftet, in diesem dummen Land, das sich abstrampelt pünktlich von morgens um sieben bis abends um fünf, ein Land voller Stempeluhrleben, ein Land, das sich zugrunde arbeitet und sich nichts dabei denkt. Das malocht ohne Ende, um das bisschen finanziellen Reichtum nicht zu verlieren, ein Land, das Angst hat, seiner Privilegien verlustig zu gehen, wenn es nicht funktioniert wie ein Fliessband. Ein Land, das die Lebenszeit verloren hat und stur wie eine ferngesteuerte Armee funktioniert.
Ein Land, das so kämpft mit der Zeit, dass es, wenn der Tag verblasst, abends so geschlagen ist, dass es sich nur noch betäuben möchte auf gepolsterten Krankenbetten und dann in einen traumlosen Schlaf fallen, damit es am nächsten und am übernächsten und am überübernächsten Tag weiter und wieder marschieren kann. Ein Land manchmal, so kommt es mir vor, das Angst hat vor dem Leben und es deshalb unterdrückt. Es reglementiert und konditioniert und portioniert auf ein bisschen Wochenende und ein paar Tage all-inclusive in einem Liegestuhl am Hotelpool.
Zuallererst wünschte ich mir für dieses Land eine gepflegte Kultur des eleganten Tagediebstahles. Menschen, die ihre Arbeit unterbrechen, die Bude verlassen und mal einen Espresso trinken, übers Sein und Nichtsein plaudern oder über Bierpreise, es ist egal. Die sich entschleunigen, wie man das heute so sagt, die sich ausklinken und fallen lassen dorthin, wo das wirkliche Leben zu Hause ist, wo das Bewusstsein auf ein Sein trifft, das die eigentliche Arbeit ist. Ich wünschte mir für dieses Land weniger Sicherheit und mehr Gelassenheit, mehr Provisorisches als Perfektes, und ich fordere die gesetzliche Verankerung einer Siesta zwischen 14 und 16 Uhr, eigentlich lieber 17 Uhr, aber ich will da mal nicht übertreiben, «tranquillo». Zwischen 14 und 16 Uhr also döst das Land dann vor sich hin oder geht ausgiebig Mittagessen oder macht Liebe, schliesst seine Geschäfte, ist herrlich unproduktiv, erholt sich, kommt zur Ruhe und zu Kräften, beginnt um 16 Uhr den Tag zum zweiten Mal, arbeitet bis um 19 Uhr und lebt dann weiter in die Nacht.
Ich weiss, das alles sind Schwärmereien eines temporären Tagediebes, der gerade morgens um sieben Mitte März eingehüllt in einen Bademantel auf einer Hotelterrasse auf Mallorca sitzt und sich vorstellt, wie es sein könnte, wenn sein Land das Leben nicht einfach so vorbeiziehen lassen würde. Natürlich könnte ich das Leben in meinem Land eintauschen gegen eines in einem andern Land, und vielleicht mache ich das eines Tages, wenn die Zeit reif ist dafür und die Enttäuschung über mein Land gross genug auch.
Und bis es so weit ist, sitze ich, so oft es geht, auf Hotelterrassen wie jener in Puerto Portals und träume mir mein Land zurecht, bis ich zurückkehre in mein Land und anfange, von Hotelterrassen zu träumen.
Es gab eine Phase in meinem Leben, da spielte ich viel mehr, als ich es tatsächlich war, den existenziellen Playboy. Ich suchte mir also die Jetset-Gedanken des Existenzialismus und umgab mich mit ihnen, so wie sich ein Playboy mit schönen Frauen umgibt. Damals wusste ich nur ganz wenig vom Leben und überhaupt nichts vom Sterben. Ich war frei, die Welt ein Witz und der Tod absurd. Ich wollte besser schreiben als Hemingway, war in Prinzessin Stephanie von Monaco verliebt, und ich merkte nicht, dass ich mich als ein Versprechen auf später lebte, von dem ich überzeugt war, dass ich und mein Ich irgendwann in Erfüllung gehen würden. Ich schrieb ganze Notizhefte voll mit allem, was mir auffiel, und allem, was ich nicht begriff, und ich schrieb lange Briefe an Gisela, die in Südamerika herumreiste, mit schwarzer Tinte auf blauem Luftpostpapier, schickte sie postlagernd an die Botschaften in Bolivien, Venezuela, Uruguay. Ich schrieb über die Bücher, die ich alle schreiben wollte, über die Kurzgeschichten, an denen ich gerade sass, und dass wir uns verlieben könnten, wenn sie wieder hier sei.
Ich schreibe das jetzt hier, weil ich die Notizbücher in einer vergessenen Schublade entdeckt habe, und die kleinen, schwarzen Büchlein sind ausser ein paar Fotos und Erinnerungen das Einzige, das mir eine Idee gibt, was das für ein Gefühl war, der junge Bahnerth zu sein. Dieses Dasein der ersten Entwürfe der Selbstverwirklichung, das Suchen nach dem Ich und dieses beinahe göttliche Zutrauen, dass alles gut werden würde. Das Leben war schön, ich sah nicht schlecht aus, hatte einen hübschen Hintern, hasste Langeweile und konnte sehr schöne Liebesbriefe schreiben. Ich kostete den Nektar des Schmerzes ebenso leicht und schmerzlos wie jenen der Schönheit, ich konsumierte, mich zuallererst, es gab nichts Wichtigeres als mich selbst, meine Existenz, und tiefe Empathie konnte ich nur für mich aufbringen, dafür reichlich. Ich war so selbstverliebt und auf egozentrischer Selbstverwirklichung, dass ich keine Augen mehr hatte, die wirklich aus mir herausschauten. So war das damals, als der Augenblick alles war und die Ewigkeit nichts, und es war schön, dieses Dasein, das nur die Vergänglichkeit des Augenblickes kannte, nicht aber jene des Lebens. Und dann war es vorbei, es ging wie bei einem langsamen Platten, kaum spürbar zuerst, und als der Felgen des Selbst auf dem Boden der Realität schrammte, sah ich im Rückspiegel all die Träume und Versprechen, und ich fuhr zuerst durch einen Tunnel ohne Licht am Ende, und als ich durch den Tunnel durch war, war die Welt eine andere, voll von brüchiger Wirklichkeit. Der Verlust der Jugend fühlte sich an, als ob die Unendlichkeit zur Endlichkeit schrumpfte. Aber irgendwann, ich glaube spätestens in Marseille, wo ich eine Zeit lang das Leben suchte, in der Bar Treiz im Panier, nachmittags, als Randy Crawford aus den Lautsprechern rieselte mit dieser verzweifelt hoffnungsvollen Sehnsucht … «We’ve only got a short time to grab a little glory, I wanna have a good life, not a sad story» …, da tat sich ein Licht auf, so was in der Art, ich kann es nicht genau erklären, aber es war ein kleiner Augenblick der Ewigkeit oder die Ewigkeit als grosser Augenblick, und ich ging ein Notizheft kaufen und einen Bleistift und fing nochmals fast von vorne an.
Читать дальше