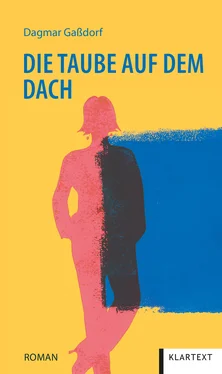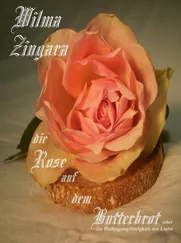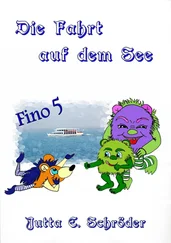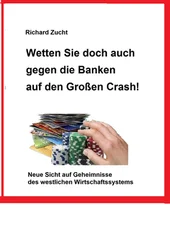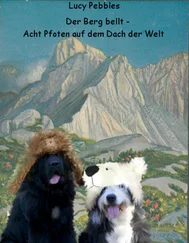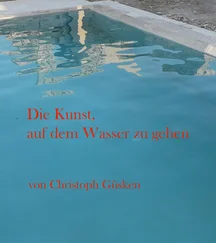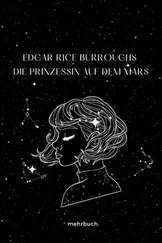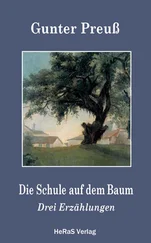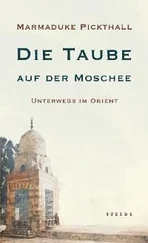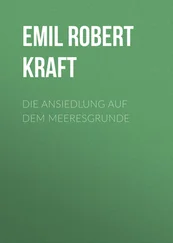Dass die Eigenheiten des Opas seiner Akzeptanz in der Familie keinen Abbruch taten, war besonders nach dem Tod seiner Frau einer stattlichen Knappschaftsrente zu verdanken, die er wegen seiner Staublunge bezog. Denn „am Magen“ mochte er es nach eigener Überzeugung haben; doch „an der Lunge“ hatte er es tatsächlich. Das machte den Bergbau-Opa bei allen seinen Kindern und deren Familien trotz seiner allseits bekannten kommunikativen Defizite zum umworbenen Hausgenossen, besserte dieses Familienmitglied doch das Haushaltsbudget auf, ohne groß zu stören. Denn den überwiegenden Teil seiner Tage verbrachte der Opa auf der Küchen-Eckbank und las Zeitung.
Ob er, wenn er sonntags vormittags im feinen Zwirn und mit gebügeltem Hemd zum Frühschoppen ging, gegenüber seinen Kumpels in der Kneipe genauso wortkarg war, konnte niemand sagen. Die Welt der Bergbau-Veteranen war eine ganz eigene, in sich geschlossene. Eines Tages wären sie ohnehin alle „weg vom Fenster“ – eine Wendung, die der Neigung der Silikose-Geschädigten geschuldet war, zu ihren Lebzeiten am offenen Fenster nach Luft zu schnappen, bis sie irgendwann eben „weg vom Fenster“ waren.
Barbara würde vermutlich eine kräftige Lunge entwickeln, denn täglich ging sie zu Fuß zur Schule, zwei Kilometer hin und zwei Kilometer zurück. Näher gab es keine katholische Volksschule, und ein Bus oder gar eine Straßenbahn fuhr auf der Strecke nicht. Auf Wunsch der Mutter holte sie die am Wege wohnenden Klassenkameraden ab – im Fall der Monika aus der Bukowina vorgeblich aus Christlichkeit (schließlich gehörte es sich nicht, Leute zu verachten, weil bei ihnen Kämme auf dem Esstisch lagen), aber ehrlicherweise wohl wegen der Sicherheit, denn in der Gruppe zu gehen war für die Kinder immer noch besser als allein. Und die Kinder aus der Bukowina wussten sich zu wehren.
Am Wege wohnte nämlich auch Uwe, ein etwas älterer, sogenannter böser Junge mit einem ebenso „bösen“ Hund, der Freude daran hatte, vorbeikommende jüngere Kinder ohne erkennbaren Anlass zu quälen. Von Ludwig, den Barbara noch vor der Monika abholte und der von seiner verwitweten Mutter mit der strengen Hochsteckfrisur nur „Luckilein“ gerufen wurde, war in solchen Situationen kaum Hilfe zu erwarten.
Luckilein, ein sehr früh in die Höhe geschossener, dünner Junge, saß beim Abholen meist zusammengefaltet zu einem Häuflein Elend auf der Treppe zu seinem Kinderzimmer im ersten Stock. Im Winter hörte man ihn schon von draußen heulen, weil er spätestens im Angesicht der zweiten Schneeflocke seine schweren Skischuhe anziehen musste, denn dies war die Zeit, in der federleichte Funktionskleidung noch nicht erfunden war.
Auch Barbaras Bruder Bernd, zwei Jahre jünger als sie und zwei Klassen unter ihr, heulte gelegentlich aus Wut. Er aber besonders im Sommer, wenn Mutter Hildegard ihn nötigte, die ungeliebte kurze Lederhose anzuziehen. Bernd kam sich in dieser aus Bayern importierten Trophäe der Eltern, die sie aus ihrem ersten, in der Wirtschaftswunder-Euphorie gebuchten Urlaub mitgebracht hatten, vor wie ein Dorfdepp aus Oberammergau und fürchtete den Spott seiner kleinen Ruhr-Kumpel. Mit zornrotem Gesicht nahm er die Ohrfeigen hin, die er als Quittung bekam, nachdem er sich auf der Flucht vor Uwe an einem Stacheldrahtzaun einen Winkelhaken in das von Mutter mit Schuhcreme polierte Glanzstück gerissen hatte.
Bernd war insgesamt eher widerständig. Er war Linkshänder und hasste es, in der Schule als solcher vorgeführt zu werden. Er hasste es auch, am Sonntag neben der großen Schwester zum Kirchgang abkommandiert zu werden – morgens zum Hochamt unter dem strengen Blick der Eltern, die hinter den Kindern die lange Straße zur Kirche hinunter gingen, und nachmittags noch einmal zur Andacht mit der „Bohnenstange“ allein. Denn Barbara war schon früh in die Höhe geschossen, während Bernd immer noch der süße kleine Junge mit rundem Gesicht und Kulleraugen war.
Er war der hübscheste Messdiener, den sie in St. Blasius jemals gesehen hatten, und quittierte Sprüche wie „Fünf Minuten vor der Zeit ist Ministranten-Pünktlichkeit“ bei der Wandlung durch besonders lautes und heftiges Bimmeln mit der vierteiligen, glänzenden Messing-Glocke. Daran musste Barbara Jahrzehnte später denken, als ein Geschichtsprofessor in einem vornehmen Zirkel einmal genüsslich über die an der Ruhr geläufige Form der Beschimpfung im Akkusativ philosophierte: „Sie strubbeligen Messdiener, Sie!“
Im Hause Brinkmann war es verpönt, sich der Ruhrgebietssprache zu bedienen. Da hatte Mutter Hildegard ein strenges Ohr drauf. Da sie nicht studiert hatte, wusste sie zwar nicht, was der Unterschied zwischen einem Dia lekt und einem Sozio- lekt ist; aber da aus ihren Kindern „mal was Besseres“ werden sollte, schien ihr „Komma“ doch besser als Bezeichnung für ein Satzzeichen geeignet denn als Verkürzung für „komm einmal“. In Bayern oder Schwaben, so dachte Hildegard Brinkmann, sprachen sie alle Bayerisch oder Schwäbisch, bis hin zu den Ministerpräsidenten; zu Hause aber, an der Ruhr, sprachen die erfolgreichen Leute Hochdeutsch. Es sei denn, sie seien zugezogen; dann durften sie auch als Chefs weiter ihren fremden Dialekt reden, und man fand das in Ordnung.
Die restriktive Einstellung der Mutter in diesen Dingen konnte Barbara aber nicht daran hindern, mit heimlichem Vergnügen Formen nachzuspüren, die in deren Kategorien eindeutig „Gossensprache“ waren, deren sprachliche Eleganz sie aber für die Mülltonne ebenso eindeutig zu schade machten. Nur laut aussprechen durfte man so etwas nicht; das gab Ärger. Und so dachte Barbara, als sie im Alter von zehn Jahren erstmals die sonst nur ihrer Mutter zustehende Ehre hatte, Heiligabend den Christbaum zu schmücken, und das Lametta und die Schätze („aber bitte nur die silbernen“) aus dem Seidenpapier barg: „Das ist für am Christbaum zu hängen.“ Sie hatte nämlich gerade angefangen, Englisch zu lernen, und war voller Bewunderung für Verkürzungen wie coffee to go ; und da hatte diese verachtete Ruhrgebietssprache eine Konstruktion von vergleichbarer Virtuosität! Irgendwie war ihr das Ansporn, diese Tanne mit allen für am Christbaum zu hängenden Kerzen, Kugeln und Sternen, wenn auch wunschgemäß nur in Silber, zu einem Kunstwerk zu machen, dessen Glanz durch „Engelhaar“ den letzten Schliff bekam. Barbara wusste, dass Eitelkeit eine Sünde war; aber sie konnte sich nicht helfen: Dieser Baum würde noch schöner als der ihrer Mutter, und der konnte man ein Händchen in dekorativen Dingen nun wirklich nicht absprechen.
Da brauchte man nur auf die Geschenke zu sehen, die da bereits fertig verpackt lagen und ihre Wirkung nicht etwa dem Einsatz teuerster Papiere und Schleifen verdankten, sondern der fantasievollen Wiederverwendung von Materialien, die andere weggeworfen hätten: Stoffreste, Glöckchen von Schoko-Osterhasen, noch grüne Zweige vom ausgemusterten Adventskranz und so weiter. Eigentlich, so dachte Barbara später, als die grüne Bewegung aufkam, hätte die Mutter, die sie im Verdacht hatte, CDU-Anhängerin zu sein, grün wählen können. Was sie wirklich gewählt hat? Die Antwort auf diese Frage sollte Hildegard Brinkmann wie so viele andere mit ins Grab nehmen; darüber wollte sie nicht sprechen. Das war tabu.
Manchmal ist es gut, wenn Menschen etwas nicht mehr miterleben. Hätte ihre Mutter, so denkt Barbara heute, es verstanden, dass Menschen sich vor Google und anderen Fremden völlig entblößen? Wie sie kein Problem damit haben, dass es da einen Apparat in den USA gibt, der alles über sie weiß, wo es doch für Hildegard Brinkmann schon der Gipfel der Peinlichkeit gewesen wäre, sich nackt vor ihren Kindern zu zeigen? Schließlich hatte sie die Nazis erlebt und wusste, was es bedeutet, in einem System der Überwachung zu leben. Die Bequemlichkeit mit dem Verlust der Privatsphäre bezahlen – dieses Geschäftsmodell der modernen Welt wäre ihr vermutlich unheimlich gewesen.
Читать дальше