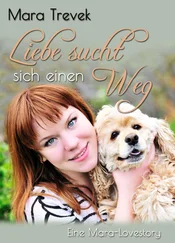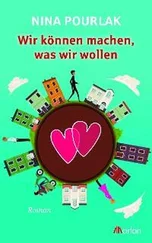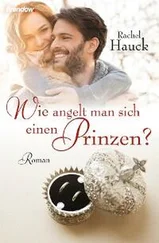Als einflussreiche Publikationen sind darüber hinaus auch die Graffiti-Fotobücher „Subway Art“ von COOPER UND CHALFANT (1984) und – etwas später veröffentlicht – „Spraycan Art“ von CHALFANT UND PRIGOFF (1987) zu nennen, die auf eine umfangreiche Dokumentation der Szeneaktivitäten abzielen. COOPER UND CHALFANT sowie CHALFANT UND PRIGOFF beschreiben beispielsweise die Entstehung der Szene, stellen ihre Sinnschemata und das Vokabular der Szene vor. Darüber hinaus liefern diese beiden Fotobücher das Bildmaterial, mit dem Graffiti in der ganzen Welt bekannt wird. In der Szene wurden „Subway Art“ und „Spraycan Art“ so populär, dass sie als „Bibel[n] der Sprüher“ bezeichnet werden (VAN TREECK 2001: 48).
In Deutschland setzt die wissenschaftliche Beschäftigung mit Graffiti Mitte der 70er-Jahre ein – und damit zu einer Zeit, in der das Szenegraffiti in deutschen Städten noch gar nicht angekommen ist.4 Inspiriert durch die amerikanischen Autoren und bedingt durch das Medieninteresse an der strafrechtlichen Verfolgung des Schweizer Sprayers Harald Naegeli entstehen bereits ab 1975 erste Publikationen, die primär wissenschaftlichen Disziplinen wie der Kunst- und Kulturwissenschaft zugeschrieben werden können.5 Zu nennen sind hier etwa HAUBENSAKS Artikel „Graffiti als Herausforderung“ (1975), VERSPOHLS Essay „Mene mene tekel peres“ (1980) und GRASSKAMPS Ausgabe zum Thema „Graffiti und Wandbilder“ in der kunstwissenschaftlichen Zeitschrift „Kunstform International“ (1982). MÜLLER veröffentlicht 1985 einen wissenschaftlichen Sammelband mit dem Titel „Graffiti“, in dem es primär um Wandinschriften aller Art (z.B. auch um Toilettengraffitis), aber auch bereits um das amerikanische Szenegraffiti geht.
Am Rande sei hier bemerkt, dass HAUBENSAK in seinem Aufsatz von 1975 interessanterweise bereits auf die große Bedeutung der Namen im amerikanischen Szenegraffiti aufmerksam macht:
Sie schreiben ihre Namen auf die Wände, meistens Spitznamen oder Pseudonyme […] und fügen Zahlen oder Codes hinzu, welche sich auf ihre Strassen und Hausnummern oder Schulklassen beziehen. In der ganzen Stadt warten Hunderte von Jugendlichen, beladen mit Spraydosenfarben, um irgendwo eine Wand mit ihrem Namen zu bemalen: „Hit the wall with your name“ ist der Schlachtruf, und im Ghetto heisst „schlagen“: zu Fall bringen. (HAUBENSAK 1975: 575)
Von Graffitis in Deutschland, die in eine Szene eingebunden sind, ist in diesen Publikationen allerdings noch nichts zu lesen. Auch WELZ bezieht sich 1984 in ihrem Aufsatz „Die wilden Bilder von New York City“ noch ausschließlich auf ihre Beobachtungen während eines Auslandaufenthaltes in den USA.6
Erste Publikationen, in denen über die Anfänge des Szenegraffitis in Deutschland berichtet wird, entstehen Ende der 80er-Jahre. Hier ist beispielsweise auf die Werke des Kunsthistorikers STAHL (1989, 1990, 2012) zu verweisen, der beschreibt, wie sich in vielen europäischen Städten „Jugendliche mit den Helden des New Yorker Untergrunds identifizier[en]“ und deren Praktiken, Ausdrucksformen und deren Vokabular übernehmen (1989: 90). Ab Mitte der 80er-Jahre – und damit mit Herausbildung der deutschen Szene – geraten auch zunehmend die Akteure mit ihren sozialen Kontexten in den Blick der deutschsprachigen Graffitiforschung. Es entstehen überblicksartige Werke, die Einblicke in Vokabular, Tätigkeiten und Hierarchien der Szene geben. Zu nennen sind hier „Das Graffiti-Lexikon“ des Ethnologen KREUZER (1986) und das „Graffiti Lexikon“ des Sozialpädagogen VAN TREECK (1993).7
In diesem Zeitraum entstehen auch Werke aus der Szene heraus, d.h., Writer beschreiben die Szene in eigenen Publikationen, in denen sie ihre Erfahrungen schildern und privates Bildmaterial präsentieren. In diesem Zusammenhang sind etwa KARL (1986) und die seit 1994 beim Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf erschienene Buchreihe „Graffiti-Art“8 zu nennen. Die Autobiographie des Berliner Writers ODEM ([1997], 2008) zeugt ebenfalls von dem Interesse, die Graffitiszene möglichst authentisch, d.h. durch Mitglieder der Szene, zu beschreiben.
Zudem erscheinen verschiedene soziologische und sozialpädagogische Studien mit zum Teil sehr spezifischen Fragestellungen, in denen die Einstellungen der Akteure zu unterschiedlichen Themen untersucht werden (zur deutschen Szene vgl. z.B. SCHMITT UND IRION 2001, SACKMANN ET AL. (Hg.) 2009, zur amerikanischen Szene MACDONALD 2001, RAHN 2002, SNYDER 2009). Die Ergebnisse dieser Studien basieren typischerweise auf qualitativen Interviews.
In den 90er-Jahren lässt sich eine zunehmende kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Graffiti beobachten. Im gleichen Zeitraum bildet sich auch die Street-Art aus der Graffitiszene heraus, deren Akteure stärker bildorientiert arbeiten und mit Papierschnitten, Stencils (mittels Schablonen gefertigte Werke) und Figuren auch neue, eigene Formen hervorbringen. Im Verlauf dieser Entwicklung werden Graffitis verstärkt in kunstwissenschaftlichen Abhandlungen berücksichtigt und dabei häufig zusammen mit Street-Art-Werken in den Blick genommen (vgl. dazu GOTTLIEB 2008, WACŁAWEK [2011], 2012, REINECKE 2012).
Auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen findet eine Beschäftigung mit dem Phänomen Graffiti statt, z.B. im Bereich der Medienwissenschaft (vgl. dazu DITTMAR 2009), der Psychologie (vgl. dazu RHEINBERG UND MANIG 2003), der Rechts- und Kriminalwissenschaft (vgl. dazu BEHFOROUZI 2006, JEREMIAS 2010) und der Politikwissenschaft (vgl. dazu KLEE (Hg.) 2010). Die Perspektiven auf Graffiti unterscheiden sich dabei stark; im Bereich der Rechts-, Kriminal- und Politikwissenschaft wird Graffitiwriting beispielsweise primär als delinquentes Verhalten perspektiviert.
1.3.2 Graffiti als Forschungsgegenstand der Linguistik
Es gibt bislang erst einige wenige Untersuchungen, die Graffitis aus einer (schrift-)linguistischen Perspektive in den Blick nehmen. Das liegt zum einen daran, dass das Interesse der Schriftlichkeitsforschung lange Zeit primär den Formen ausgebauter Schriftlichkeit, also konzeptioneller Schriftlichkeit, galt (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2016: 101). Graffitis zeichnen sich jedoch gerade dadurch aus, Formen minimaler Schriftlichkeit zu sein, d.h., sie bestehen oft nur aus einzelnen Wörtern oder Phrasen und bleiben auch in ihrer Bedeutung mitunter rätselhaft (TOPHINKE 2017: 161ff.). Als solche minimalen Formen standen sie zunächst weniger im Fokus der linguistischen Forschung. Zum anderen ist die relativ späte Beschäftigung mit Graffiti auch so zu begründen, dass die (Schrift-)Linguistik stärker an normgetreuen Formen der Schriftlichkeit orientiert war. Normabweichende Schreibungen, wie sie im Graffiti häufig zu finden sind, gerieten kaum in den Blick, was sicherlich auch im „stark normativ geprägten Verständnis von Schriftlichkeit begründet [liegt], das sich in schreibdidaktischen Zusammenhängen vermittelt“ (SCHUSTER UND TOPHINKE 2012a: 14).1
Darüber hinaus stellten Graffitis auch aufgrund ihrer besonderen bildlichen Gestaltung ein „Randphänomen“ der Linguistik dar (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2012: 181). Wie PAPENBROCK UND TOPHINKE schreiben, bildeten Graffitis für die Linguistik aufgrund ihres „bildhaften Charakters“ einen eher untypischen Gegenstand (2012: 181). Die visuelle Erscheinung von Schrift wurde bis vor wenigen Jahren nicht als relevanter Forschungsgegenstand der Linguistik betrachtet.2 Erst im Zuge der Erkenntnis, dass Schrift weitaus mehr leistet, als mündliche Sprache aufzuzeichnen, fand auch die visuelle Seite der Graphie zunehmend Berücksichtigung.3
Um die linguistische Beschäftigung mit dem Phänomen Graffiti möglichst systematisch darzustellen, werden im folgenden Abschnitt einige wichtige Publikationen chronologisch vorgestellt und diskutiert.
Erste linguistische Publikationen, die sich mit Graffiti im weitesten Sinn auseinandersetzen, erscheinen in den 80er-Jahren.4 In diesen frühen Veröffentlichungen werden Graffitis häufig als informelle, jugendsprachliche Äußerungen perspektiviert. BLUME (1980, 1981) untersucht Graffitis etwa als „schriftliche sprachliche Äußerungen auf Tischen, Stühlen, Wänden und Türen von Klassenzimmern“ und gliedert diese Äußerungen anschließend nach syntaktischen und semantischen Typen (1980: 173). NEUMANN fasst in ihrer Dissertation 1986 Gaunerzinken, Tramperspuren und weitere Zeichen an der Wand als Graffitis auf und stellt den oppositionellen Anspruch dieser Zeichen heraus. Sie deutet diese Zeichen als „Widerstand gegen standardisierte Kommunikation“ und als „Aufstand der Normalsprache“ (NEUMANN 1986: 270). NEUMANN nimmt in dieser Arbeit auch eine sprachwissenschaftlich orientierte Kategorisierung der Graffitis vor und legt dabei bereits eine Kategorie mit „Namen und Pseudonyme[n]“ an (1986: 91ff.). Auf der Grundlage einzelner Beispiele aus ihrem Korpus stellt sie fest, dass die Namen „einen grafischen Überschuß“ haben und sich mit Ornamenten und Pfeilen zu „Buchstabenfiguren“ zusammensetzen (NEUMANN 1986: 100).
Читать дальше