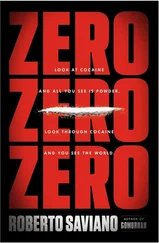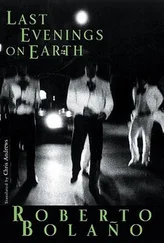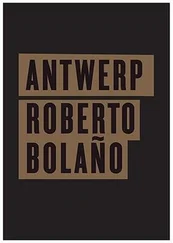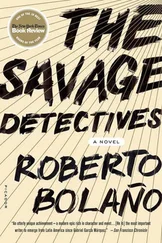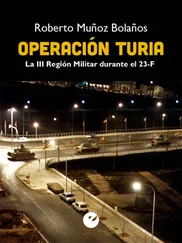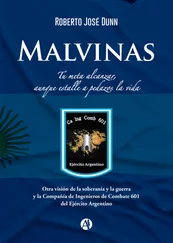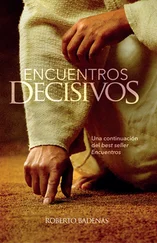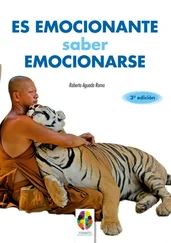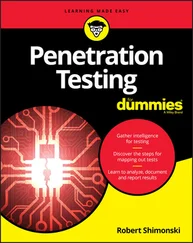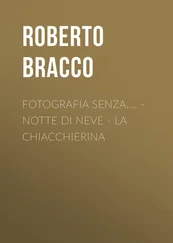Das Ergebnis jedenfalls lautet jeweils Freispruch und zeigt: Die Mehrheit der Theaterbesucher (63%) und Fernsehzuschauer (87%) denkt oder fühlt verfassungswidrig. Denn es widerspricht dem Eingangsparagraphen des Deutschen Grundgesetzes über die Unantastbarkeit der Menschenwürde, Leben gegen Leben abzuwägen und gegebenenfalls wenige unschuldige Menschen zur Rettung vieler unschuldiger Menschen zu töten. Entgegen dem moralischen Impuls der Mehrheit besagt die ethische Grundlage der deutschen Rechtsprechung, dass Menschenwürde nicht absolut geachtet werden kann, wenn sie zahlenmäßig verhandelt wird. Das heißt: Das kleinere von zwei Übeln lässt sich weder mathematisch ermitteln noch durch Diskriminierung nach Alter, Geschlecht oder kulturellen Wertmaßstäben. Das Leben von zehn Menschen ist nicht mehr wert als das von zwei und das Leben eines Greises nicht weniger als das eines Kindes.
Die Ethik des unverhandelbaren Subjekts verbietet, einen Menschen auf ein Mittel zur Rettung anderer zu reduzieren. Das hat Konsequenzen für die Organtransplantation – man darf nicht einen Gesunden opfern, um zehn Kranke zu retten – und selbst für das Verzehren Schiffsbrüchiger: Man darf nicht den Schwächsten, schon Sterbenden töten, um die eigene Überlebenschance zu erhöhen. Essen darf man den anderen nur, wenn er sich selbst dazu anbietet oder per Losverfahren zustimmt – wie in Herman Melvilles Moby Dick , Edgar Allan Poes Bericht des Arthur Gordon Pym und vielen anderen Seefahrergeschichten. Die Zustimmung erhebt das Objekt der Tötung in den Status des Subjekts, das nicht auf ein Rettungsmittel reduziert wird, sondern sich zum Retter bestimmt.
Die deutsche Verfassung bevorzugt mit dem Verbot der Instrumentalisierung des Menschen die (deontologische) Pflichten- oder Gesinnungsethik gegenüber der (konsequentialistischen) Zweck- oder Verantwortungsethik. Die Zweckethik – zu der auch der Utilitarismus gehört, prominent propagiert durch den Moralphilosophen Jeremy Bentham – blickt auf das Ergebnis und hält die Opferung der wenigen zur Rettung der vielen durchaus für vertretbar. Die Gesinnungsethik – vehement vertreten durch Benthams Zeitgenossen Immanuel Kant – blickt auf das Handeln (im vorliegenden Fall der Abschussentschluss des Majors) und bewertet die (negative) Pflicht, niemanden zu töten, höher als die (positive) Pflicht, Menschen zu retten. Das Tötungsverbot ist hier kategorisch , also unabhängig von den Umständen und Konsequenzen; der Zweck heiligt nicht die Mittel. Moralisches Verhalten ist so dem Gesetz verpflichtet und nicht dem Kollektiv, dessen höchstmögliche Lust beziehungsweise niedrigstes Leid der Utilitarismus favorisiert. Aus eben diesem Grund kassierte das Verfassungsgericht Anfang 2006 Paragraph 14 Absatz 3 des Luftsicherheitsgesetzes, das der Bundestag ein Jahr zuvor verabschiedet hatte. Begründung: Verstoß gegen die Menschenwürde. Der Paragraph erlaubte im Terrorfall als Ultima Ratio den Abschuss von Passagierflugzeugen. Das deutsche Verfassungsgericht war 2006 keineswegs so weit wie die Mehrheit des deutschen Theaterpublikums ein Jahrzehnt später.
In der Philosophie wird das Dilemma des Tötens, um Leben zu retten, als „Trolley-Problem“ oder „Weichenstellerfall“ diskutiert: Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht, fünf Personen zu überrollen. Die einzige Handlungsoption eines Zeugen neben dem Weichenhebel besteht darin, die Bahn auf ein Nebengleis umzuleiten, wo sie nur eine Person überfahren würde. Der Tötungsbeschluss, den diese Weichenstellung enthält, wird in der sogenannten Fetter-Mann-Variante explizit, in der man alternativ die Straßenbahn dadurch zum Halten bringt, dass man einen fetten Mann von der Brücke auf die Schienen stößt. Ja, philosophische Konstruktionen sind manchmal voller Grausamkeit und Humor. Denn es ist ebenso brutal, einen völlig unbeteiligten, aber hinreichend fetten Mann im Interesse der Lebensrettung in den Tod zu stürzen, wie es skurril ist, dass sein wesentlich dünnerer Gegner, der offenbar nicht genug Fett für den Rettungsakt auf die Schiene bringt, den Zweikampf gewinnt.
Dieses philosophische Gedankenexperiment wird nicht nur durch Schirachs Gerichtsdrama in die Realität nach 9/11 versetzt. Zeitgleich erfolgt dies in Gavin Hoods Film Eye in the Sky (2015), in dem es darum geht, ob man ein unschuldiges Mädchens töten darf, um per Drohnenbeschuss einen Terroranschlag in Nairobi zu verhindern. Der Terroranschlag würde mindestens 80 Menschen das Leben kosten, darunter sicher auch mehrere Mädchen gleichen Alters. Die Diskussion der Beteiligten und Verantwortlichen an ihren Bildschirmen in London und Nevada übersetzt die deontologischen und konsequentialistischen Argumente ins Anschauliche des Mediums Film, mit berührenden Bildern aus dem Leben des Mädchens und einem Wettrennen mit der Zeit, um das Mädchen vom geplanten Detonationszentrum wegzulocken. Die Rettungsversuche sind Gott sei Dank ohne Erfolg. Das Mädchen stirbt an den Folgen des Drohneneinschlags.
Gott sei Dank, weil so das ethische Problem, um das es dem Film geht, präsent bleibt. Jedes Happy End wäre Betrug am Konflikt, vor dem die Menschheit steht. Denn es wird im Kampf gegen die Terroristen nicht nur Kollateralschäden geben. Es wird auch Stimmen geben, die diese im Interesse der Gesellschaft rechtfertigen. 1 zu 80 spricht eine klare Sprache, nicht nur für die Vertreter des Utilitarismus. Auch aus Sicht der Soldaten ist – in Hoods Film ebenso wie in Schirachs Theaterstück – der Kollateralschaden in Kauf zu nehmen, um mehr Opfer zu vermeiden. Soldaten wissen, dass zivile Opfer in Gefechtssituationen unvermeidbar sind. Der Unterschied, davon lebt der Film, besteht darin, dass in Gefechtssituationen zivile Opfer passieren , während hier, im Besitz aller Daten über die Situation und ihre Folgen, wissentlich geopfert wird: mit Bild und Namen des Mädchens, das sterben muss. Bedauerlich, aber, aus Sicht der Verantwortungsethik, moralisch vertretbar.
Philosophische Gedankenexperimente lassen sich nicht auf Kompromisse ein. Das unterscheidet sie vom wahren Leben und dessen fiktionaler Darstellung. So findet man in Schirachs Drama das Argument, der Major verhindere durch den Abschuss des Flugzeugs die Möglichkeit, dass die Passagiere den Terroristen rechtzeitig überwältigen oder die Allianz-Arena rechtzeitig evakuiert wird. Spekulation auf den guten Ausgang und Unwägbarkeiten der wirklichen Schäden sind deontologische Ablenkungsmanöver, um sich vor der Entscheidung zu drücken. Worauf das Flugzeug bei von Schirach und die Drohne bei Hood zusteuern, ist die Abwägungsresistenz der Menschenwürde. Worum es geht, ist die Aktualisierung des Rechtsempfindens angesichts neuer Sachlagen.
In der Logik des Trolley-Problems gibt es das Happy End nur als Selbstopferung: wenn man selbst der fette Mann ist und freiwillig auf die Schienen springt. Schirachs Major hatte diese Möglichkeit nicht, bei Hood setzt der kenianische Antiterroragent vor Ort sein Leben für die Rettung des Mädchens aufs Spiel. Wir mögen die Chance zur Selbstopferung haben, wenn wir in einem Unfall, vor die Möglichkeit gestellt, das Auto gegen ein Kind statt viele Erwachsene zu steuern, oder umgekehrt, unbeirrt auf die Häuserwand zuhalten. Und wir werden erst dann, in unserem vielleicht letzten Moment, wissen, ob wir in der Lage waren, diese Chance zu nutzen. So jedenfalls verhielt es sich bisher. Anders wird es, wenn Algorithmen am Steuer sitzen.
Es gibt dazu noch keinen Film, aber die Diskussion, nach welchen Kriterien Algorithmen in autonomen Fahrzeugen über Leben und Tod entscheiden, wenn sich die Alternative zwischen Kind, Greis und Wand ergibt, ist in vollem Gange. Der deutsche Verkehrsminister schuf im Mai 2016 eine Kommission unter Vorsitz eines früheren Bundesverfassungsrichters, um „ethische Fragen beim Paradigmenwechsel vom Autofahrer zum Autopilot“ zu klären. Das im Juni 2017 vorgelegte Ergebnis untersagt „strikt“ für eine unausweichliche Unfallsituation „jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution)“ und verbietet eine „Aufrechnung von Opfern“, da das Individuum „sakrosankt“ ist. 4
Читать дальше