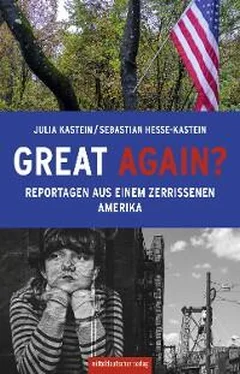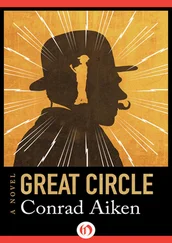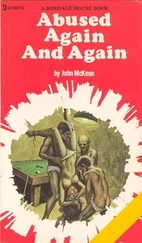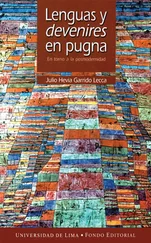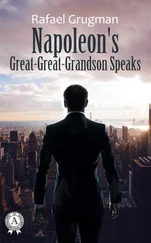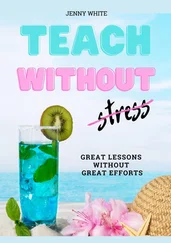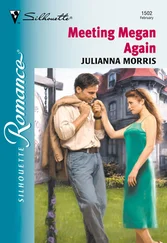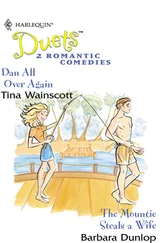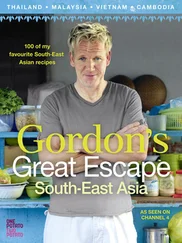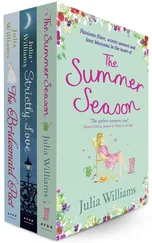Mitte Mai 2020 sorgt dann eine Gruppe von Republikanern für Aufsehen, die sich »Lincoln Project« nennt. Es ist die Woche, in der sich Trump vor der pompösen Kulisse des Washingtoner Lincoln-Memorials von seinem Haussender Fox News zur Pandemie befragen lässt. Das »Lincoln Project« lässt zeitgleich ein TV-Video ausstrahlen, das sich ästhetisch bewusst an Wahlkampf-Spots von Ronald Reagan, dem republikanischen Übervater, anlehnt. In dem Video heißt es unter anderem: »Dank Donald Trumps Führung ist unser Land schwächer, kränker und ärmer.« Mit der Wortwahl machen sich die Initiatoren über Vizepräsident Mike Pence lustig, der Trumps Corona-Task-Force geleitet hat und bei den TV-Briefings jeden zweiten Satz unterwürfig mit den Worten begann: »Dank der großartigen Führung von Präsident Trump …« Treibende Kraft des »Lincoln Projects« ist George Conway.
Trump tobt. Und feuert per Twitter voll unter die Gürtellinie: »Ich weiß nicht, was Kellyanne ihrem geistesgestörten Loser von einem Ehemann, Mondgesicht, angetan hat«, so der Präsident der Vereinigten Staaten, »aber das muss ziemlich schlimm gewesen sein!« Trump liebt es, seinen Gegnern nicht nur gehässige Beinamen zu verpassen (Sleepy Joe Biden, Crazy Nancy Pelosi, Shifty Adam Schiff, Mini Mike Bloomberg etc.), er verteilt gerne auch herabwürdigende Spitznamen (etwa Alfred E. Newman, nach der Witzfigur aus den MAD-Heften, für Pete Buttigieg). Jetzt also Moonface, Mondgesicht, für George Conway. Und der lässt erwartungsgemäß nicht locker und legt am 7. Mai in der Washington Post nach: »Extreme Narzissten überhöhen ihre Leistungen und Befähigungen – und so hat Trump sein ganzes Leben damit verbracht, ein falsches Bild seiner selbst zu schaffen – nicht nur für andere, sondern für sich selber, um sein zutiefst zerbrechliches Ego zu schützen.«
Die »George and Kellyanne Conway Show« ist ohne Ende unterhaltsam. Der »Never Trumper« (das ist die gängige Bezeichnung für diejenigen, die nie ein gutes Haar an dem Präsidenten lassen) und die Chef-Propagandistin: US-Journalisten schlecken sich die Finger danach, eine Homestory über die zwei machen zu können. Um herauszukriegen, was hier Inszenierung ist und was echt. Conways konservativer Rosenkrieg triff auch deshalb einen Nerv, weil viele Amerikaner aus Erfahrung wissen, wie sich ein Trump-gemachter Riss durch die eigene Familie anfühlt.
In Julias und meinem engsten Freundeskreis gibt es auch ein Paar, das politisch nicht auf gleicher Wellenlänge liegt. Wenn man Nancy Flinn und Dick Weiss besucht, dann liegen immer zwei Tageszeitungen auf dem Wohnzimmertisch. Die Washington Post und die Washington Times. Nancy liest die Post. Dick liest die Times. Die Post ist das Leib- und Magenblatt der weltoffenen Liberalen. Die Times dagegen bedient das andere Lager. Mehr Reagan als Trump. Aber während der Corona-Krise (wie im ersten Kapitel erwähnt) rückte das Blatt stramm auf die Linie der sogenannten »Alt-Right«, der ultrakonservativen »alternativen Rechten«, der jegliches staatliche Handeln ein Gräuel ist und die entsprechend scharf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen schoss. Liest man die beiden Washingtoner Zeitungen parallel, dann gewinnt man schnell den Eindruck, die Blätter schildern unterschiedliche Realitäten aus getrennten Paralleluniversen. Doch Nancy und Dick sind ein zauberhaftes Beispiel dafür, dass gegensätzliche politische Philosophien der Liebe nicht im Wege stehen müssen.
Beide leben in Nancys Haus auf der Poplar Street in Georgetown. Das ist eher ein Seitengässchen als eine wirkliche Straße. Nancys Backsteinhäuschen im Kolonialstil hat die kuriose Hausnummer 2714 ½, wie in einem Harry-Potter-Roman. Das Townhouse ist so schmal und hutzelig, dass es wohl keine vollwertige Hausnummer verdient. Es verfügt zwar über drei Stockwerke, ist aber gerade einmal drei Meter breit. Wenn überhaupt. Das Wohnzimmer, in dem wir sitzen, ist wie ein Schlauch geschnitten und wunderbar vollgestopft mit allerhand kuriosen Dingen. Den meisten Platz nehmen ein altes Karussellpferd aus Holz, dessen Farbe weitgehend abgeblättert ist, und ein Stutzflügel ein. Auf dem Kaminsims stehen hölzerne Sakralfiguren, die aus mittelalterlichen Kirchen in Südfrankreich und Katalonien stammen. Im nordspanischen Girona lebt Nancys Sohn Jason. Dort züchtet er mit seinem Partner Appaloosa-Pferde und handelt mit Antiquitäten. Hin und wieder schickt er Nancy einen seiner Funde. Als Wohnzimmertisch fungiert eine alte Seemannskiste. Darauf liegt das Einzige, was Nancy und Dick trennt: die Washington Post und die Washington Times. Kein anderer Haushalt in Washington DC dürfte beide Blätter gleichzeitig beziehen.
Julia und ich haben Nancy Flinn im Jahre 2000 kennengelernt. Nancy war frisch verwitwet. Ihr zweiter Mann Rick, den sie heute noch »die Liebe meines Lebens« nennt, war im Alter von 56 Jahren gestorben. Nancy lebte allein mit Winston, einem kalbgroßen Labradoodle, in dem kleinen, schmalen Townhouse auf Georgtowns Poplar Street, das sie einst mit Rick teilte und jetzt mit Dick. »Ich besitze elf Toiletten«, erzählte sie damals. Ansonsten sei sie »hausarm«. Beides Anspielungen darauf, dass sie in Washington, auf Cape Cod und in Vermont Immobilien besaß. Allerdings mit hoher Hypothekenbelastung. Unsere erste Begegnung fand im Hundepark statt, im Rose Park, in dem allabendlich die Hundebesitzer von Georgetown zusammenkamen, die Hunde spielen ließen, ausgelesene Bücher austauschten und einem Sundowner niemals abgeneigt waren.
Am 13. März 2002 lernte Nancy Dick Weiss kennen. Das genaue Datum blieb deshalb im Gedächtnis, weil das Kennenlernen über ein Dating-Portal im Internet zustande kam. Nancy war 61, Dick 62, und ebenfalls verwitwet. Nach drei Jahren platonischer Freundschaft funkte es dann richtig: Auf einem gemeinsamen New-York-Trip wurde erstmals ein Hotelzimmer geteilt. Vom Temperament her ergänzen sich die beiden bestens: Sie leicht chaotisch, auffallend, redselig und extrovertiert; er kontrolliert, zurückhaltend, eher schweigsam und in sich gekehrt. Für ein Biopic würde ich sie mit Diane Keaton besetzen, ihn mit Tommy Lee Jones. Achtzehn Jahre nach ihrem Kennenlernen sitze ich mit den beiden bei unserem Lieblings-Mexikaner in Georgetown, bei »Don Lobo’s«. Und staune unvermindert, wie sich zwei so zusammenraufen können, die aus so unterschiedlichen Vorleben kommen. Nancys leichten Hang zum Chaos gleicht Dick mit Engelsgeduld aus. Ein symbiotisches Paar. Wenn da nicht die Politik wäre. Dick ist Erz-Republikaner. Nancy durch und durch progressiv. Knallt’s da nicht oft? »Mir gefällt ein gepflegter Streit!«, lacht sie. Er schweigt. Am 3. November 2012, als Barack Obama wiedergewählt wurde, waren die beiden bei Nancys Buchklub-Freundinnen eingeladen, allesamt leidenschaftliche Demokratinnen. Es ging hoch her an diesem Abend. »Für mich grenzte das an Missbrauch«, erinnert sich Dick grummelnd an diesen Abend. Und erzählt kopfschüttelnd von einer Freundin von Nancy, die gelegentlich vorbeischneit, die Zeitung aufschlägt und ihn anfaucht: »Dann wollen wir doch mal schauen, was deine Republikaner uns heute wieder angetan haben!«
Dass ein politischer Riss durch ihre Familie geht, ist Nancy von Kindesbeinen an gewöhnt. Ihr Vater war Republikaner, ihre Mutter Demokratin. Kein einfaches Elternhaus, aus dem sie stammt. Nancys Vater, Herausgeber mehrerer Zeitungen in Vermont, fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Unter Mordverdacht stand Nancys Mutter, eine Alkoholikerin, deren Trinken ständiger Anlass für erbitterten Streit war. Die Tat wurde nie aufgeklärt. Nancys Vorfahren, die Belknaps, sind familiengeschichtlich so etwas wie amerikanischer Adel. »Meine Großmutter hat immer voller Stolz betont, unsere Familie sei auf der Mayflower in die Neue Welt gekommen«, erzählt sie. Im Jahre 1620 hatte das mythische Schiff 102 Pilger aus Plymouth im Hafen von Provincetown, heute Massachusetts, abgesetzt. Die Mayflower wurde zu einer amerikanischen Ikone. In den Adern waschechter Mayflower-Nachfahren fließt blaues Blut. Nancys Großmutter war aufgrund dieses Stammbaumes Mitglied der ebenso prestigeträchtigen, wie elitären Frauenorganisation »Daughters of the Revolution«. Doch die hat sie später aus Protest gegen deren Rassismus verlassen. Nancys Großeltern väterlicherseits waren aus Irland eingewandert, während der Großen Hungersnot auf der Grünen Insel. Wie so viele Iren ließen sie sich in Boston nieder. Später zogen die Belknaps weiter nach Vermont, wo Nancys Großvater mehrere Lokalzeitungen herausgab.
Читать дальше