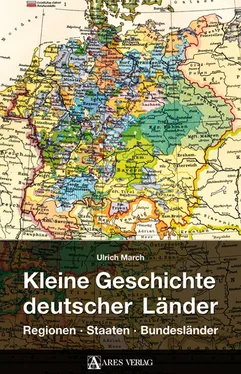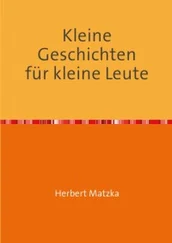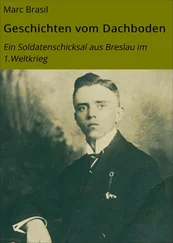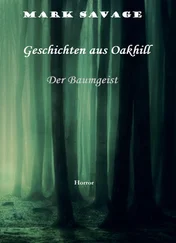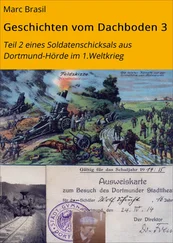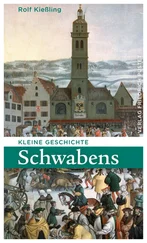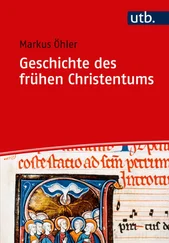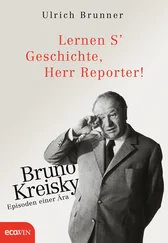Im Zeitalter Barbarossas und seiner beiden Nachfolger Heinrich VI. (1190–1197) und Friedrich II. (1215–1250), die noch stärker nach Italien ausgerichtet sind, nimmt Schwaben auf Grund seiner geographischen Lage eine Schlüsselstellung ein. Umso ärgerlicher ist es daher für die Staufer, daß mit den Welfen und den Zähringern zwei Dynastien im südwestdeutschen Raum mit ihnen konkurrieren, die ebenfalls den Herzogstitel führen und über weite Landesteile Schwabens gebieten, die Welfen vor allem in der Umgebung von Altdorf/Weingarten, die Zähringer in der Schweiz und im Breisgau. Erst mit dem Aussterben dieser beiden Familien gewinnen die Staufer die uneingeschränkte Führungsstellung in der Region. Ihre Machtmittel setzen sie nun noch stärker – nicht anders als die Reichsterritorien in Franken, in Thüringen oder im Harzraum – für reichspolitische Zwecke ein.

Die einstige staufische Kaiserpfalz in Bad Wimpfen
Der staufische Stammsitz ist zunächst die Burg Büren (Wäschenbeuren), dann die von dem ersten bedeutenden Vertreter des Geschlechts, Friedrich von Büren, erbaute Burg Hohenstaufen in Stauf bei Göppingen. Seine Gemahlin bringt beträchtlichen Besitz aus der Oberrheinebene, vor allem im Raum Schlettstadt, in die Ehe ein; seither fassen die Staufer mehr und mehr im Elsaß Fuß. Nachdem sich bereits die Ottonen hier festzusetzen suchten, dabei aber nicht sehr weit kamen, wird nun eine Burg nach der anderen errichtet. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ist das Elsaß bereits so gut befestigt, daß der Geschichtsschreiber der Stauferzeit, Otto von Freising, es als militärisches Kerngebiet des Reiches bezeichnet („vis maxima imperii“).
Mit dem Erwerb der salischen Hausgüter im Worms- und Speyergau überschreiten die Staufer die Stammesgrenze nach Norden. Dies geschieht auch an anderen Stellen im Süden des fränkischen Siedlungsgebiets; die Bezeichnung „schwäbisch“, zum Beispiel in dem Ortsnamen „Schwäbisch Hall“, bedeutet hier soviel wie „staufisch“.
Auch durch ihre Ministerialen- und Städtepolitik bauen die Staufer Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete des Elsaß und der Schweiz immer mehr zu einer Bastion des Kaisertums aus. Zu den bereits vorhandenen Reichsburgen treten ständig neue, vor allem im schwäbischen Kernland, im Elsaß und in dem Gebiet zwischen Main und Oberrhein, aber auch in Mitteldeutschland, etwa in Thüringen und im Vogtland. Diese Burgen werden durchwegs mit zuverlässigen Reichsministerialen besetzt, die vor Ort die Interessen des Reiches wahrnehmen und dessen militärisches Rückgrat darstellen, nicht nur wegen des Festungscharakters ihrer Burgen, sondern auch durch ihre Teilnahme an den Italienfeldzügen. Daß sie nach dem Ende der staufischen Dynastie um die Mitte des 13. Jahrhunderts nicht anders als die Fürsten und Städte ihre eigene Interessenpolitik betreiben, steht auf einem anderen Blatt.
Vorwiegend fiskalischen Zwecken dient der Ausbau des schwäbischen Städtewesens, den die Staufer, zunächst im Wettbewerb mit den Welfen und Zähringern, von Anfang an betreiben; der Südwesten wird in mancher Hinsicht – etwa durch das „Freiburger Stadtrecht“ – zu einem Ausstrahlungsraum für die neue Siedlungs- und Wirtschaftsform. Zu den ältesten Städten der Region gehören neben der zähringischen Gründung Freiburg im Breisgau (1120) unter anderem Hagenau, Breisach, Schwäbisch Gemünd, Bopfingen, Giengen, Ulm, Ravensberg, Memmingen und Überlingen.
Mit dem Erwerb des süditalienischen Normannenreiches durch die Heirat Heinrichs VI. mit Konstanze von Sizilien wird das Stammland der Staufer noch stärker in die europäische Politik einbezogen. In seiner Deutschlandpolitik konzentriert sich beider Sohn, Friedrich II. von Hohenstaufen (1215–1250), stärker noch als seine Vorgänger auf seine unmittelbaren Herrschaftsgebiete und baut daher die politische Machtstellung des Kaisertums gerade in seinem schwäbischen Herzogtum systematisch weiter aus. So werden während seiner Regierungszeit zahlreiche weitere Städte gegründet, darunter Esslingen, Heilbronn, Biberach, Wangen, Lindau, Kaufbeuren, Schaffhausen, Nördlingen, Weil der Stadt, Leutkirch und Reutlingen. Wenn es später in keinem Teil Deutschlands auch nur annähernd so viele Freie Reichsstädte gibt wie im Südwesten, so ist dies im wesentlichen der staufischen Städtepolitik des 12. und 13. Jahrhunderts zu verdanken.
Klar erkennbar ist das Bestreben Friedrichs II., die Verbindungswege von Schwaben nach Italien zu sichern. 1241 erwirbt er deshalb die Grafschaft Allgäu, von wo aus der Fernpaß und der Reschenpaß nach Oberitalien führen, einige Jahre zuvor bereits die Talschaft Uri im Kerngebiet der späteren Schweiz und damit den Zugang zu dem damals eröffneten Gotthardpaß. Auch der Zusammenhang mit Burgund wird aufrechterhalten. Nachdem Hochburgund, die spätere Freigrafschaft, bereits 1189 reichsunmittelbares Territorium geworden ist, erhebt Friedrich II. auch das an der Rhônemündung gelegene Arles in den Rang einer Freien Reichsstadt.
Nach dem Tod des letzten Stauferkönigs Konrad IV. (1250–1254) macht König Alfons von Kastilien, Sohn einer Tochter König Philipps von Schwaben (1198–1208), Erbansprüche geltend, sowohl auf das Reich als auch auf das Herzogtum Schwaben; er kann sich aber nicht durchsetzen. Dagegen erreicht der blutjunge Konradin, der Sohn Konrads IV., beim schwäbischen Adel seine Anerkennung als Herzog. Auf diesen Rückhalt gestützt, versucht er vergeblich, das an das Haus Anjou verlorene Süditalien zurückzugewinnen, stirbt vielmehr im Alter von 16 Jahren durch Henkershand auf dem Marktplatz von Neapel. Damit endet die siebenhundertjährige Geschichte des Herzogtums Schwaben.
H. „Block in der deutschen Geschichte“ (Herzogtum Bayern)
Plötzlich, nach den ältesten, sehr unsicheren Quellen im Jahre 508, sind sie da: eine ethnische Gruppe unbekannter Herkunft und Zusammensetzung, die sich „Baiwari“ nennt. Es spricht einiges dafür, daß es sich um einen gemischten Verband handelt, der sich in Böhmen gebildet hat. Jedenfalls müssen sich die „Baiwari“ vor der Landnahme in der Nähe ostgermanischer Völker aufgehalten haben, da das Bayerische von allen westgermanischen Sprachen dem Ostgermanischen am nächsten steht. Die eigentliche Stammesbildung vollzieht sich erst nach der Einwanderung, vorzugsweise im Raum Regensburg – Ingolstadt – München, wo sich die Neuankömmlinge zu einem erheblichen Anteil mit Alemannen und in ebenfalls beträchtlichem Ausmaß mit Römern, genauer mit romanisierten Kelten, mischen. Auf diese Weise konstituiert sich – zunächst im Bereich der mittleren Donau und im Alpenvorland – eine eigenständige, zukunftsträchtige ethnische Großgruppe, die das historische Geschehen im südlichen Mitteleuropa und darüber hinaus bis heute entscheidend bestimmt hat. Bayern liegt nicht nur „seit 1500 Jahren wie ein Block in der deutschen Geschichte“ (Stadtmüller); der östliche Teil des Stammesgebietes, Österreich, hat darüber hinaus europa- und weltgeschichtliche Bedeutung gewonnen.

Der „Tassilo-Kelch“ (um 768–788)
Bis zum Jahre 1156, also fast 650 Jahre lang, besteht ein gesamtbayrischer Stammesstaat mit der Hauptstadt Regensburg, wo die Herzöge aus dem Haus der Agilolfinger (bis 788) an der „Porta Praetoria“ der Römerstadt „Castra Regina“ ihre Pfalz errichten; noch im 10. Jahrhundert weist die Stadt, die bei der bayrischen Landnahme weder umkämpft noch zerstört wurde, ein römisches Erscheinungsbild auf. Straßenzüge und Gebäude, Handwerks- und Landwirtschaftstechniken bleiben erhalten.
Читать дальше