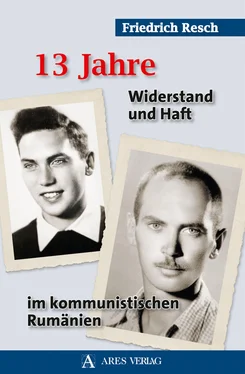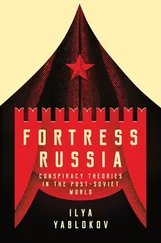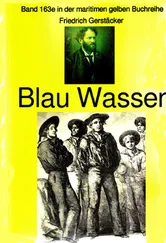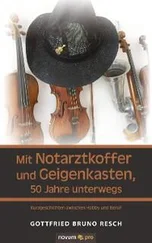Im gleichen Zusammenhang erfuhren wir Ende Januar per Brief, dass Onkel und Tante Barth, als sie am Tage, bevor die Verschleppung begann, hörten, dass sie auch auf der Liste standen, beschlossen hatten, mittels Morphium aus dem Leben zu scheiden. Als die Häscher nach Mitternacht zu ihnen kamen und an Tor und Fenster polterten, öffnete niemand. Auf den Lärm hin kam aus dem Nachbarhaus der Notar, der die Tür öffnete und das Ehepaar in bewusstlosem Zustand vorfand. Ein aus dem Werkskrankenhaus herbeigerufener Arzt konnte sie beide retten, und sie entkamen sogar der Verschleppung. Später erfuhren sie auch, wer sie seinerzeit trotz der überschrittenen Altersgrenze auf die Verschleppungsliste gesetzt hatte.
Nach dem 23. August 1944 begannen die Kommunisten, schrittweise die politische Macht im Lande an sich zu reißen. Zwar wurden anfangs auch bürgerliche oder sozialdemokratische Politiker mit Regierungsämtern betraut, doch von einer Regierung zur nächsten wurde der Anteil der Kommunisten größer und jener der anderen Parteien geringer. In der Regierung des Jahres 1946, die schon zum Großteil aus Kommunisten bestand, war außer Teohari Georgescu und Gheorghe Gheorghiu-Dej zum Beispiel auch noch Lothar Radaceanu als Vertreter jener Sozialdemokraten dabei, die nunmehr mit sowjetischer Hilfe den Weg der „Roten“ zur absoluten Machtübernahme ebneten. Dies führte zur Groza-Regierung, welche – nach anfänglichen Vorbehalten – am 04. 02. 1946 auch von den Regierungen Großbritanniens und der USA anerkannt wurde. Nach dieser Quasi-„Absegnung“ durch den Westen begannen die Kommunisten – von Moskau angeleitet –, sich der „nützlichen Idioten“ zu entledigen, die sie vorher zum Zwecke der Tarnung gebraucht hatten. So wurde Ana Pauker anstelle von Gheorghe Tătărescu Außenministerin und Emil Bodnăras an Stelle von General Răscanu Kriegsminister.
Seit dem Umsturz waren bloß sechs Monate vergangen, aber die Verwandlung Rumäniens von einer konstitutionellen Monarchie in eine kommunistische Vasallenrepublik schritt mit beschleunigtem Tempo voran. Der letzte Akt sollte dann Ende 1947 folgen, als man die demokratischen Politiker mit politischen Prozessen überzog und ihre Parteien verbot. Die erzwungene Abdankung des Königs im gleichen Jahr war nur noch eine symbolische Handlung, denn entmachtet war das Königshaus faktisch schon seit dem Umsturz. Die Regierungsbezeichnung „Frontul National Democratic“ (Demokratische Nationale Front) vom 30. 12. 1947 konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kommunisten sowjetischer Prägung an der Macht waren. Dieses schnelle Abgleiten des Landes in eine linke Diktatur und vor allem die Art und Weise, wie dies geschah, gab Anlass genug, sorgenvoll in die Zukunft zu blicken.
Am augenfälligsten war die geschilderte Entwicklung anhand der von Woche zu Woche penetranter werdenden linken Propaganda zu erkennen. Die Plakate und Schmierereien an den Hauswänden waren nicht zu übersehen. Wenn an den zahlreichen Kundgebungen auch bürgerliche Parteieăn teilzunehmen wagten, kam es häufig zu wüsten Schlägereien, die in aller Regel von der Linken provoziert wurden. Auch die Gewerkschaften waren zu jener Zeit bereits vollkommen unterwandert. Die kommunistischen Zellen in den Unternehmen waren sehr aktiv und verhinderten in ihrem Wirkungsbereich durch Gewalt und Terror jegliche Einflussnahme anderer Parteien. Wenn es zu Schlägereien kam, hielt sich die Ordnungspolizei für gewöhnlich raus, man wollte es sich ja nicht – erst recht nicht, solange die Sowjets im Lande waren – mit den voraussichtlichen neuen Machthabern verscherzen. So wurde zum Beispiel während der Wahlkämpfe von 1946 in Arad der bürgerliche Politiker Professor Constantin Teodorescu von kommunistischen Schlägern ermordet. Studenten, die sich für nicht-linke Parteien engagierten, wurden von roten Schlägertrupps regelrecht gejagt und häufig krankenhausreif geschlagen. Täter wurden so gut wie nie ermittelt.
Vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklung und natürlich nicht unmaßgeblich beflügelt von jugendlicher Abenteuerlust beschloss ich, im Rahmen meiner Möglichkeiten Widerstand zu leisten. Ich wollte den Russen, die ich wie fast alle Leute meines Bekanntenkreises unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit als fremde Besatzer empfand, schaden. Als erstes wollte ich, dass schien am ehesten machbar, ihre Telefonleitungen kappen. Die Idee stammte ironischerweise aus einem sowjetischen Propagandafilm, den ich als ersten dieser Art in einem Kino der Stadt gesehen hatte. Dort wurde unter anderem gezeigt, wie Partisanen Fernsprechleitungen der Wehrmacht zerschnitten und so deutsche Angriffspläne vereitelten.
Die Gelegenheit, eine erste spontane Sabotageaktion durchzuführen, bot sich, als ich eines Abends von einem Besuch bei meinem Freund Stefan Winkler zurückkehrte. Die Winklers wohnten ganz in der Nähe der sowjetischen Kommandantur, die im ehemaligen deutschen Konsulatsgebäude und der schon erwähnten Rieger-Villa untergebracht war. Von dort führten zahlreiche Telefonleitungen durch den Eminescu-Park zu verschiedenen Dienststellen der Russen in der Stadt. Ich näherte mich von der Parkseite aus der Kommandantur und zerschnitt ein ganzes Bündel von Fernsprechleitungen an zwei verschiedenen Stellen. Die so herausgetrennten Drähte schleifte ich ein gutes Stück mit und warf sie anschließend in den Bega-Kanal. Solange ich mich noch in der Nähe der Kommandantur befand, gab es keinen Alarm. Daraus schloss ich, dass man meine Tat noch nicht entdeckt hatte. Am nächsten Tag stellte ich fest, dass ab sofort an der Kommandantur nicht nur an der Vorderseite wie bisher, sondern auch hinten, also an der Parkseite ein Posten stand und dass zusätzlich nunmehr auch eine Patrouille im Park ihre Runden drehte. Heute muss ich zugeben, dass meine damalige Aktion kaum einen Sinn gehabt hat, aber für mich und meine Familie eine große Gefahr darstellte. Wenn die Russen mich damals geschnappt hätten, wäre ich wahrscheinlich ohne viel Federlesens an die Wand gestellt worden, und meinen Eltern wäre es vermutlich auch nicht gut ergangen.
Dennoch habe ich nach einigen Monaten eine weitere, ebenfalls spontan geplante Aktion durchgeführt. Auch diesmal war ich im Park unterwegs, als ich eine tief hängende Telefonleitung erspähte. Ich schaute mich flüchtig um, bemerkte dabei jedoch nicht, dass zwei russische Soldaten nur etwa 50 Meter von mir entfernt von Büschen verdeckt auf einer Bank saßen. Ich war vollständig überrascht, als ich, nachdem ich die Leitung an einer Reparaturstelle geöffnet hatte und wieder fallen ließ, sofort Schreie hörte und die zwei Russen hinter dem Busch hervorsprangen. Ich rannte los, hörte das „Stoj, stoj!“ und fast gleichzeitig das Rattern einer MPi-Salve. Die Kugeln rauschten gut hörbar in den Baumblättern. Ich wetzte in einem Affentempo in das nächste Gebüsch und weiter fort, bis die Russen mich nicht mehr zu sehen vermochten. Nach diesem Abenteuer hatte ich für eine Weile genug – der Schrecken war zu groß gewesen.
Wie bei vielen Jungs meines Alters gehörte es damals zu meinen „Hobbys“, heimlich das überall noch reichlich vorhandene Kriegsgerät zu sammeln. So war ich bereits im Herbst 1944 nach meiner Rückkehr aus Ferdinandsberg wiederholt in den von den Bombenangriffen heimgesuchten Stadtvierteln unterwegs, um nach nicht verbrannten Teilen angloamerikanischer Stabbrandbomben, deren überwiegender Anteil aus Elektron, einer Legierung aus Aluminium, Zink und Phosphor, bestand, zu suchen. Wozu dies dienen sollte, darüber hatte ich vorerst allerdings noch keine genaue Vorstellung. Jedenfalls wurde ich fündig und versteckte etliche der Brandbomben daheim. Wenn mein Vater dann nicht zu Hause war, zerlegte ich die Dinger in seiner Werkstatt und entnahm die verschiedenen Brand- und Explosivfüllungen, die ich sorgfältig aufbewahrte. Die Außenwand der Bomben konnte ich auf der Drehbank meines Vaters zu Spänen zerkleinern. Diese Späne waren leicht entzündbar und brannten mit einer blendend weißen Flamme bei einer dabei entstehenden Temperatur von bis zu 3000 Grad.
Читать дальше