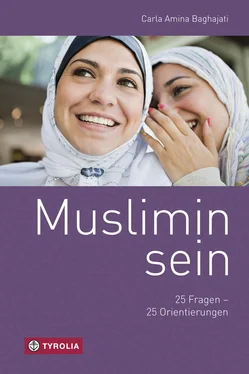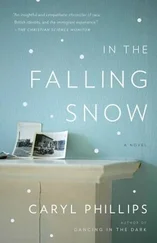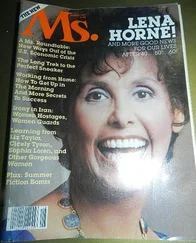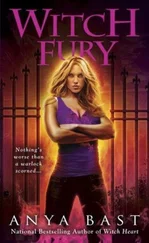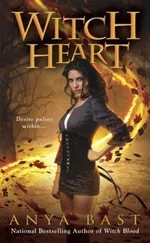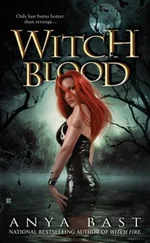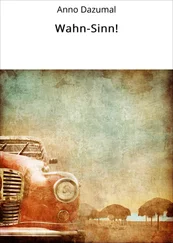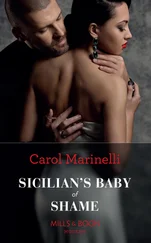Der Koran wurde schon früh interpretiert und daraus sind berühmte Exegeten hervorgegangen. Auch wenn der Koran in seinem Wortlaut von Gott stammt und nicht veränderbar ist, verändert sich doch unser menschliches Verständnis. In die Exegese fließen Methoden ein, wie „den Koran durch den Koran“ zu erklären. Ein Vers oder Textabschnitt wird so durch einen anderen, der vielleicht in einer ganz anderen Sure vorkommt, erläutert. Diese inneren Zusammenhänge werden von den Exegeten hergestellt. Das ist auch darum wichtig, weil dadurch verhindert wird, dass einzelne Verse isoliert betrachtet werden. Selektive Wahrnehmung bildet ein großes Problem immer dann, wenn Verse – oft sogar wissentlich in manipulierender Absicht – fern des Gesamtkontextes betrachtet werden und dann zu völlig falschen Schlüssen führen. Mitunter verwenden Exegeten auch Parallelstellen aus den Heiligen Schriften der beiden verwandten Buchreligionen, Judentum und Christentum. Dies darf aber nicht dazu führen, dass zentrale Aussagen des Korans verfälscht werden. Im vorliegenden Buch wird öfter auf den tafsir von Muhammad Asad verwiesen. Dieser hat den Vorteil, berühmte Exegeten erst zu rezipieren und dann eine eigene Abwägung zu leisten. Als Intellektueller des 20. Jahrhunderts trifft er einen Ton, der dem modernen Leser entgegenkommt.
Aktuelle Kontextualisierung
Eine moderne Auslegung steht vor der Herausforderung, die Lebensumstände heutiger Muslime zu berücksichtigen, freilich ohne in Beliebigkeit zu verfallen und willkürlich eine Anpassung voranzutreiben. Der Prophet selbst wies immer wieder darauf hin, dass es Lebensbereiche gibt, wo der Islam eine klare Linie und Ziele vorgebe und doch ein längerer Prozess von Nöten sei, um durch gesellschaftliche Veränderungen und Bildung schrittweise dieses Ziel zu erreichen. Dies trifft gerade auf die Frage des Verhältnisses der Geschlechter zu. So revolutionär damals viele Maßnahmen gewirkt haben müssen, muss man sich heute mehr deren Zielrichtung vergegenwärtigen, als nur stur nachahmen zu wollen, was damals geschah. Dann können auch im heutigen Kontext Wege gefunden werden, um traditionelle Rollenbilder von Mann und Frau in Richtung Geschlechtergerechtigkeit positiv zu verändern.
GOTTESDIENST
1. Wie stehen Mann und Frau in ihrem Menschsein zueinander?
Eva – Verführerin des Mannes. Eva – Verkörperung der Sünde. Die Frau an sich als Schuldige für die Vertreibung aus dem Paradies. Über Jahrhunderte wurde die abendländische Vorstellung geprägt von dieser Urerzählung, die Frauen potentiell verdächtig machte, den Mann vom geraden Wege abzubringen. Trotz anders lautender wissenschaftlicher christlicher Auslegungen zur biblischen Erzählung vom Sündenfall ist die Vorstellung von der Frau als personifizierte Versuchung tief verwurzelt. Im Mittelalter trug die bildende Kunst dazu bei, in der Neuzeit auch die Literatur, wie etwa John Miltons „Paradise Lost“. Heute beziehen sich Werbestrategen in ihrer Bildlichkeit auf Eva und die von ihr ausgehende Verlockung: Da ein Joghurt mit Botticelli-Eva, dort eine Frau im Evakostüm mit Apfel in der Hand, die sich auf der Kühlerhaube eines Autos räkelt.
Im Koran findet sich die Geschichte des Sündenfalls bereits zu Beginn. 9Ich las die Stelle gleich mehrmals, weil mir irgendetwas gegenüber der vertrauten Version besonders erschien. Eva wurde von Adam nicht beschuldigt, ihn verführt zu haben! Beide tragen zu gleichen Teilen die Schuld, sich über das Verbot hinweggesetzt und vom verbotenen Baum gegessen zu haben. Da packte mich die befreiende Erkenntnis, was das allgemein für Frauen bedeutet: „Ich bin nicht die sündige Eva!“ Dieser Gedanke übt bis heute die gleiche Faszination aus. Wie hatte ich mich im Geschichtsunterricht aufgeregt, dass in mittelalterlichen Wertungslisten eine Frau sogar nach einem Mörder geführt wurde – bloß, weil dieser ja immerhin ein Mann sei.
Von Adam und Eva ausgehend lässt sich das islamische Menschenbild untersuchen. Und wieder war ich in Bann gezogen, dass Mann und Frau in ihrem Menschsein die zentrale erste Erfahrung des Scheiterns und der Wahrnehmung eigener Grenzen teilen, eines Scheiterns, von dem Gott in seiner Allwissenheit vorher Kenntnis hatte. Lernen durch Fehler – das schien hier die Botschaft zu sein. Menschsein inkludiert die Erfahrung der eigenen Endlichkeit und der Anfälligkeit für Fehler – ohne die wiederum keine Entwicklung möglich wäre. Als wäre das Erlebnis der Übertretung notwendig gewesen, um Mann und Frau auf ihr Dasein als Menschen auf der Erde vorzubereiten.
Mann und Frau bereuen ihr Verhalten zutiefst und ihnen wird durch Gottes Barmherzigkeit verziehen. Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zur christlich-jüdischen Erzählung. An dieser Stelle entsteht ein anderes Narrativ. Gott gibt ihnen für ihre Aufgabe in der Welt, in die sie nun versetzt werden, eine zentrale Erfahrung mit: das Gefühl für Verantwortlichkeit. Konsequenzen des eigenen Handelns sind persönlich zu tragen.
In der tiefen Scham, als ihnen bewusst wird, gegen den göttlichen Willen verstoßen zu haben, fällt ein zentraler Satz: „Wahrlich, wir haben gegen uns selbst gesündigt.“ 10. Die gleiche Wendung ist immer dann im Koran zu finden, wenn es um die menschliche Erkenntnis eines Fehlverhaltens geht. Was hat es mit dem „Gegen-uns-selbst-gesündigt-Haben“ auf sich? Wäre nicht viel eher zu erwarten, dass es „gegen Gottes Gebot“ heißt? Dahinter steht, dass Gott in Seiner Größe von den Sünden der Menschen unberührt bleibt. Es wäre ja absurd anzunehmen, Er sei angewiesen auf das Wohlverhalten der Menschen. Dies lässt die Formulierung „gegen uns selbst“ plausibel und angemessen erscheinen.
Erst wenn auch das Prinzip der fitrah mitgedacht wird, erschließt sich freilich die ganze Tiefe der Bedeutung. Fitrah bedeutet, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen diesem die prinzipielle Erkenntnisfähigkeit in den rechten Weg mitgegeben hat. Mann und Frau, dem Menschen schlechthin, ist nicht nur ein Gewissen mitgegeben, sondern die Möglichkeit, das Gute zu erkennen und danach zu handeln. Folgerichtig ist Adam und Eva bewusst, dass sie nicht nur gegen Gottes Gebot verstoßen haben, sondern eigentlich sich selbst untreu geworden sind. Denn der göttliche „Bauplan“ hat im Menschen eine Art Kompass angelegt, sich nach dem Guten auszurichten. So haben sie gegen sich selbst gesündigt.
Dieses grundsätzlich positive Menschenbild wird ergänzt durch Aussagen im Koran, die auf die Vermessenheit des Menschen, seine Maßlosigkeit und Selbstüberschätzung eingehen. Hier werden die dunklen Seiten des Menschen sehr deutlich angesprochen. Davon ist sogar schon unmittelbar vor der Erschaffung des Menschen die Rede, als die Engel – eigentlich bedingungslos in ihrem Gehorsam gegen Gott – das neue Wesen, das da entstehen soll, geradezu in Frage stellen: „‚Willst du auf ihr einen solchen einsetzen, der darauf Verderbnis verbreiten und Blut vergießen wird – während wir es sind, die Deinen grenzenlosen Ruhm lobpreisen und Dich preisen und Deinen Namen heiligen?‘ Gott antwortete: ‚Ich weiß, was ihr nicht wisst.‘“ 11Die Stelle weist auch auf die besondere Rolle des Menschen hin, auf der Welt „eingesetzt“ zu sein. Mann und Frau sind beide als khalifatullah , also als „Statthalter Gottes“ entsandt und tragen damit besondere Verantwortung für die Schöpfung. Dieser Gesichtspunkt wird uns noch einmal beschäftigen, wenn wir auf die politische Repräsentation zu sprechen kommen.
Die absolute Gleichwertigkeit von Mann und Frau als Menschen zeigt sich überall, wo es um das Verhältnis zwischen ihnen geht. Bereits die Geschichte der Erschaffung des Menschen macht die gleiche Bedeutung von Mann und Frau klar. Dazu sei der Beginn der vierten Sure zitiert: „O Menschheit! Seid euch eures Erhalters bewusst, der euch aus einer einzigen lebenden Wesenheit erschaffen hat und aus ihr Partnerwesen erschuf und aus den beiden eine Vielzahl von Männern und Frauen verbreitete.“ 12Mann und Frau sind also aus der gleichen Ursubstanz geschaffen und bedingen sich gegenseitig. Sie brauchen einander.
Читать дальше