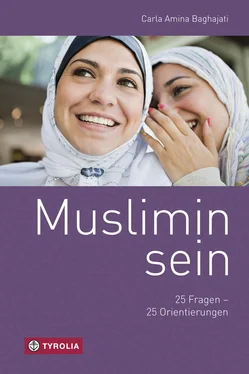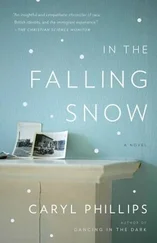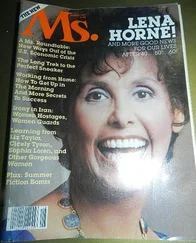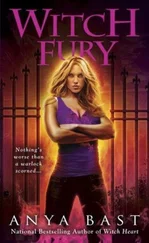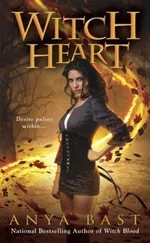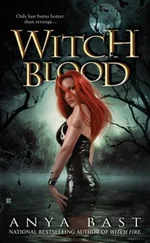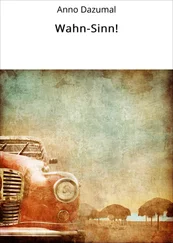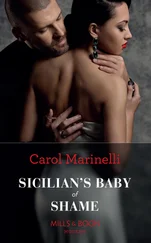In den Handbüchern für muslimische Frauen, wie sie seit dem Mittelalter immer wieder von Gelehrten zusammengestellt wurden, wird die Menstruation sehr oft unter dem Aspekt der tahara , der rituellen Reinheit, behandelt – auch dies mag ein Grund dafür sein, dass sich die fatale Assoziationskette in Richtung „Unreinheit“ der Frau bilden konnte. Nach der Beendigung der Menstruation ist eine Ganzkörperwaschung ( ghusl ) notwendig. Die rituelle Reinheit ist für manche gottesdienstliche Handlungen wie das fünfmal täglich zu verrichtende Gebet eine Voraussetzung. Dazu gibt es eine Gebetswaschung ( wudu, abdest ), bei der Hände, Mund, Nase, Gesicht, Kopf, Arme bis zum Ellenbogen und Füße gewaschen werden. Hierbei geht es nicht allein um den Aspekt der Hygiene und äußerlichen Sauberkeit, sondern um ein viel ganzheitlicheres Streben nach innerer Reinheit. Beim Waschen der genannten Körperteile sollten Gläubige auch darüber nachsinnen, was sie mit diesen seit der letzten Waschung getan haben. Wer etwa über andere schlecht geredet hat, sollte bei der Gebetswaschung ( wudu ) die Gelegenheit ergreifen, sich innerlich davon zu distanzieren, diese Tat bereuen und den Vorsatz fassen, sie nicht zu wiederholen beziehungsweise den eventuell entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Es geht also nicht um eine rein äußerliche Handlung. Die Waschung hat eine zutiefst spirituelle Seite.
Die Gebetswaschung muss nicht bei jedem Gebet erneuert werden. Sie kann gültig bleiben, wenn man dazwischen nicht in tiefen Schlaf gefallen ist. Ausscheidungen, wie Urin oder Stuhlgang, aber auch aus Blähungen resultierende Winde machen die Erneuerung der Gebetswaschung erforderlich. Uneinigkeit herrscht bei den Gelehrten über den Umgang mit einer Blutung. Wer sich etwa beim Vorbereiten von Gemüse fürs Kochen in den Finger geschnitten hat, sollte nach manchen Auslegungstraditionen seine Gebetswaschung erneuern.
Was die Blutungen der Frauen betrifft, so wird unterschieden zwischen jenen bei der Menstruation ( haid ), dem Wochenfluss nach einer Geburt ( nifas ) und solchen aus anderer Ursache ( istihada ) wie außerhalb des Zyklus auftretende Schmierblutungen. Solange eine Frau menstruiert oder noch Wochenfluss auftritt, hat das Folgen für die religiöse Praxis. Ibn Al Djauzi listet auf: „Die Menstruation verbietet das Verrichten des Gebets, und es muss auch nicht nachgeholt werden. Das Fasten ist auch verboten, muss aber später nachgeholt werden. Das Lesen des Korans, das Berühren eines Korankodexes, den Aufenthalt in der Moschee, die Umrundung des Hauses 34 untersagt die Menstruationszeit ebenfalls.“ 35
Es geht also um etliche Einschränkungen, wobei bezüglich des Betens, Fastens und des tawafs , der rituellen Umrundung der Kaaba in Mekka, ein weitgehender Konsens unter den Gelehrten besteht, obwohl, wie eingangs bereits festgestellt, eigentlich keine relevante Aussage dazu im Koran vorliegt. Ableitungen aus der gelebten Praxis der Frühzeit des Islams sind also erforderlich. Wie bereits ausgeführt gibt es hier authentische Schilderungen von Frauen im unmittelbaren Umfeld des Propheten und auch Aussagen von ihm selbst. Bei der Pilgerfahrt etwa ist interessant, dass er Frauen, die mit der Absicht, diese zu verrichten, aufgebrochen waren, erklärte, sie müssten in den Zustand der rituellen Reinheit eintreten ( ihram ) – also eine rituelle Ganzkörperwaschung vornehmen, die sonst erst am Ende der Menstruation möglich ist – und sich vor der Blutung eben mit einer Binde schützen, um sich frei bewegen zu können. 36Nicht von allen Riten der Hadsch sind menstruierende Frauen zudem ausgenommen: „ Wenn die menstruierende Frau und die Frau im Wochenbett die Zeit erreichen, sollten sie baden, in den Ihram eintreten (also wie oben) und alle Rituale (wie die anderen) ausführen, außer den Tawaf um die Kaaba .“ 37
Für die Untersuchung des Reinheitsaspekts ist besonders aufschlussreich, dass der ihram -Zustand auch für eine Menstruierende gültig ist, ja sie diesen bewusst annehmen kann. Denn dieser oft mit „Weihezustand“ übersetzte Begriff umschließt die ganze spirituelle Dimension, Gottes Nähe während der Pilgerfahrt zu suchen. Ist die Ganzkörperwaschung ( ghusl ) schon ein spiritueller Akt, so das Eintreten in den ihram noch viel umfassender und für viele Muslime ein einzigartiges Erlebnis, weil es sozusagen das Tor bildet, die Pilgerfahrt zu vollziehen, an deren Ende das Ziel steht, sich wie „neugeboren“ zu fühlen. Dass Frauen, auch wenn sie ihre Tage haben, nicht ausgeschlossen sind, zeigt ganz deutlich, dass sie während dieser Zeit eben nicht irgendwie „minderwertig“ sind. Wer dies in aller Konsequenz bedenkt, kann für sich auch viel eher annehmen, dass es beim Aussetzen von Beten und Fasten in dieser Zeit um eine wirkliche Erleichterung geht, die ihren „verletzlichen Zustand“ berücksichtigt.
Wünschenswert wäre ein reflektierter Sprachgebrauch beim Verfassen religiöser Erläuterungen. Wenn Männern erklärt wird, sie müssten sich von einer rituellen Unreinheit (Samenerguss) zuerst mit einer Ganzwaschung ( ghusl ) reinigen, ehe sie wieder beten, so findet sich nicht jener abwertende Unterton, der Texte rund um die Menstruation häufig begleitet. Wenn dagegen Frauen lesen, dass nach ihrer Periode ein ghusl vorzunehmen sei, dann oft mit dem Beisatz „damit sie ihre Reinheit wieder erlangen“, was impliziert, sie seien während der Periode „unrein“.
Dass die rituelle Unreinheit nicht mit einer den ganzen Menschen umfassenden Unreinheit zu verwechseln ist, belegt eine Episode, in der ein Mann, der sich nach dem Beischlaf noch nicht gereinigt hatte, dem Propheten schamhaft aus dem Weg ging. Dieser wies ihn zurecht, dass er sehr wohl auch in diesem Zustand neben ihm hätte sitzen können: „Preis sei Gott! Ein Muslim wird doch nie unrein!“ 38Diese Aussage bezieht sich in ihrer Allgemeingültigkeit natürlich sowohl auf Männer wie auf Frauen. Das innere Bekenntnis zum Islam bedingt bereits eine Gottesnähe, die nicht temporär durch Zeiten sehr menschlicher körperlicher Zustände – die ja alle in Gottes Schöpfung liegen! – aufgehoben werden kann.
Die monatliche Blutung als natürlichen Vorgang anzunehmen, ist wichtig für Frauen, um sich in diesen Phasen positiv wahrnehmen zu können. In der theologischen Literatur zur Menstruation gibt es eine Fülle von Datierungsvorschlägen, wie die Zeit der Regelblutung zu bemessen sei. Diese beziehen sich nicht nur auf direkte Hinweise, sondern auch auf allgemeinere theologische Erkenntnisse, von denen ausgehend Übertragungen vorgenommen werden. So manche Aussage würde einer medizinischen Überprüfung aus heutiger Sicht kaum standhalten. So zum Beispiel der schon zitierte Ibn Al Djauzi: „Wenn eine junge Frau Blut sieht und sie ist neun Jahre alt, so handelt es sich um die Menstruation. Wenn sie Blut sieht und sie ist über fünfzig Jahre, dann ist das kein Regelblut.“ Verwirrend mag auch scheinen, wie die Anzahl der Tage einer Blutung bei Hanafi auf ein Minimum von drei und ein Maximum von zehn Tagen festgelegt ist, während ein anderer der vier sunnitischen Begründer einer Rechtsschule, Shafai, von bis zu fünfzehn Tagen ausgeht. Da ist es als betroffene Frau wohl realitätsnäher, sich direkt an Aisha zu orientieren. Frauen hatten ihr einige Wäschestücke mit gelben Flecken zugesandt, weil sie wissen wollten, ob ihre Menstruation schon beendet sei. Sie kommentierte: „Seid nicht hastig, bis ihr den weißen Ausfluss seht.“ Anstatt stur Tage zu zählen, geht es also vor allem um Selbstbeobachtung. Wer das unternimmt, lernt sich und den eigenen Körper viel besser kennen und wird sich im Zyklus so auskennen, dass dies auch beim Spüren der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage hilft und insgesamt ein tieferes Körperbewusstsein und innere Balance mit sich bringt. Eine muslimische Frau mag sich auch daran erinnern, dass der islamische Mondkalender ihr das Verfolgen des Monatszyklus erleichtert, weil er sich oft mit diesem deckt.
Читать дальше