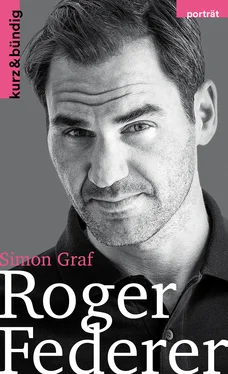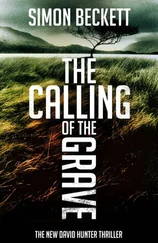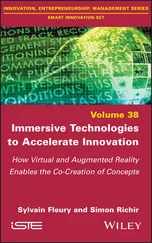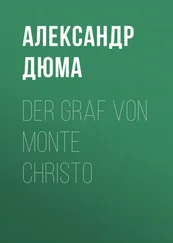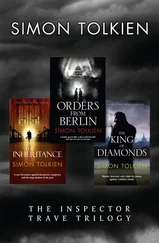Simon Graf - Roger Federer
Здесь есть возможность читать онлайн «Simon Graf - Roger Federer» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Roger Federer
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Roger Federer: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Roger Federer»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dies ist die um fünf zusätzliche Kapitel erweiterte Ausgabe des Bestsellers von 2018.
Roger Federer — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Roger Federer», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Je erfolgreicher Federer wird, desto ruhiger und beherrschter tritt er auf dem Platz auf. Oder umgekehrt. Die Meisterprüfung absolviert er in Wimbledon 2003 auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Erfolg, als er zum Titel stürmt, als sei es das Normalste der Welt. Seine Wandlung gehört zu den bemerkenswertesten im Tennis: vom Hitzkopf, für den sich die Eltern schämten, zum perfekten Botschafter für diesen Sport. Die mahnenden Worte von Mutter Lynette haben mit Verzögerung also doch ihre Wirkung entfaltet. Und wie sehr sie recht hatte, zeigt sich, als ihr Sohn seine Gegner nicht mehr in sein Innerstes blicken lässt. Er setzt ein Pokerface auf, verrät höchstens nach einem gewonnenen Punkt den Anflug einer Gefühlsregung. Das ist frustrierend für seine Kontrahenten, die sich nichts sehnlicher wünschen würden, als an seinem Gesicht oder seinen Gesten ablesen zu können, was in ihm vorgeht. Und dass es ihnen gelingt, ihn zu ärgern.
Doch Federer bleibt cool, strahlt stets eine stille Zuversicht aus. Wie ein erfahrener Pilot navigiert er in seinen Matches ruhig durch größte Turbulenzen. Und weil er wie ein guter Flugkapitän einen klaren Kopf behält, trifft er auch in kritischen Momenten fast immer die richtigen Entscheidungen. Das ist in einem rasanten Sport wie Tennis, in dem man sich auf seine Instinkte verlassen muss und nur ein paar Bälle über Sieg oder Niederlage entscheiden, oft der Unterschied. Es wird zu einem Merkmal Federers, dass er, je wichtiger der Punkt, desto besser spielt. Auf das Ass durch die Mitte bei Breakball für den Gegner kann man sich bei ihm in seinen erfolgreichsten Zeiten verlassen. Und so muten Siege in knappen Partien, die nur durch ein paar Punkte entschieden werden, bei ihm jahrelang wie selbstverständlich an. «Roger schlägt sich nicht selber», sagt der australische Tennis-Analyst Craig O’Shannessy. «Viele regen sich auf und verlieren die Übersicht, resignieren oder bekommen Panik und forcieren dann zu sehr. Roger nicht. Und allein dadurch gewinnt er schon viele Matches.»
Als Teenager ein Hitzkopf, entdeckt er also sein Zen, obschon er auf spezielle Entspannungsmethoden verzichtet. Er macht kein Yoga oder Tai-Chi, er meditiert nicht, geht auch nicht zum Shiatsu-Therapeuten. Trotzdem kann er als gutes Beispiel dienen, wie man achtsam lebt, wie man den Moment annimmt und sich von nichts ablenken lässt. Etwas, das wir in dieser hektischen Welt, die sich immer schneller dreht, fast alle anstreben. Ein schönes Beispiel, wie gut es Federer gelingt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, gibt er im ATP-Finale 2003, das erstmals in Houston über die Bühne geht: Selfmade-Millionär James McIngvale, genannt «Mattress Mack», reich geworden durch seine Möbelhäuser, hat das Turnier vor seine Haustüre geholt. Doch die Bedingungen im «Westside Tennis Club» sind alles andere als ideal. Federer erdreistet sich zu kritisieren, dass die Plätze uneben seien und die Trainingsbedingungen ungenügend. Einmal muss er sogar auf einem Platz ohne Netz trainieren. Als McIngvale, der nicht gewohnt ist, dass ihm jemand entgegentritt, von der Kritik des Schweizers erfährt, schäumt er vor Wut. Er stürmt sofort in die Garderobe und staucht diesen zusammen, als der sich gerade auf sein Spiel gegen Andre Agassi vorbereitet. Kurz irritiert, sammelt sich Federer schnell, ja er nimmt die Standpauke sogar als zusätzlichen Ansporn. Er schlägt Agassi, den Patriot McIngvale so gerne siegen gesehen hätte, gleich zweimal: zuerst in den Gruppenspielen, dann im Finale. Und Matratzen-Mack bleibt nichts anderes übrig, als Federer zu gratulieren. Der Sieger hat immer recht, nicht wahr?
Als Federer öfter zu verlieren beginnt, wird kritisiert, er sei zu ruhig, stemme sich gar nicht richtig gegen die Niederlagen. Kommentatoren fordern, er solle öfter seine Faust ballen oder «Come on!» rufen. Mats Wilander sagt sogar, er habe den Eindruck, Federer wolle einfach nur spielen und gar nicht unbedingt gewinnen. Der Schwede, mit seinen überraschenden Analysen immer wieder eine Bereicherung, liegt mit dieser Einschätzung für einmal komplett daneben. Im Frühling 2009 geschieht dann das Unfassbare: In Miami zerschmettert Federer im Halbfinale gegen Novak Djoković nach einer verschlagenen Vorhand seinen Schläger! Das Publikum pfeift, als er zur Bank läuft, um ein neues Arbeitsgerät zu holen. «Darf sich ein Vorbild für die Jugend so benehmen?», fragt die Zürcher Boulevardzeitung «Blick» entrüstet. «Ein sehr schlechtes Bild von Roger Federer», rügt die vornehme «Neue Zürcher Zeitung». Es ist sein erster Materialschaden in der Öffentlichkeit seit fünf Jahren. Jener Zwischenfall markiert aber nicht seine Wandlung zurück vom Paulus zum Saulus – er zeigt einfach, wie sehr es in Federer immer noch brodelt. Und wie bemerkenswert es ist, dass dies so selten an die Oberfläche kommt.
Interessant ist die Parallele zu Björn Borg, den er bewundert und der beim Laver Cup ab 2017 sein Kapitän im Team Europe ist. Auch Borg, der den Spitznamen «Iceborg» bekam, weil er auf dem Court keine Miene verzog, war in jungen Jahren ein Hitzkopf gewesen. Er fluchte, schmiss Schläger, mogelte. Borg führte sich so unflätig auf, dass er mit zwölf Jahren vom schwedischen Verband für sechs Monate gesperrt wurde. Auch in seinem lokalen Tennisclub in Södertälje durfte er nicht mehr trainieren – eine prägende Erfahrung, die ihm eine Lehre war. Danach verstaute er seine Emotionen in einer Kiste, schloss sie ab und warf den Schlüssel weg. Selbst positive Gefühlsregungen ließ Borg kaum mehr zu. «Wenn er vom Platz in die Garderobe kam, konnte man nie erkennen, ob er gewonnen oder verloren hatte», sagte sein früherer Rivale Ilie Năstase. «Er kam rein, streifte sein FILA-Outfit ab, legte es ordentlich zusammen und ging ruhig zur Dusche.»
Während Borg jegliche Emotionen unterdrückte, kanalisiert Federer die seinen. Nach großen Siegen und bitteren Niederlagen dringen sie an die Oberfläche, oft in Form von Tränen. Er hat das Weinen im Männertennis salonfähig gemacht. So sagt Andy Murray, nachdem er das Finale der Australian Open 2010 gegen ihn verloren hat, in seiner ehrlichen und bewegenden Rede auf dem Platz: «Ich kann weinen wie Roger. Leider kann ich nicht spielen wie er.»
5. «So ist die Welt richtig. Nicht nur die Tenniswelt!»
Eine Sportlerkarriere war Hans Ulrich Gumbrecht, genannt «Sepp», nicht vergönnt. Dafür trieb der Universalintellektuelle seine akademische Laufbahn mit sportlichem Ehrgeiz voran. 1948 in Würzburg geboren, wurde er bereits mit 26 Jahren Professor in Bochum. Von 1989 bis 2018 lehrte er Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University. Er befasst sich aber nicht nur mit Literatur, sondern schaltet sich häufig in gesellschaftliche Debatten ein. Und, was bei Intellektuellen eher verpönt ist: Er ist begeisterter Sportfan. 2006 publizierte er das Buch «Lob des Sports» (Original: «In Praise of Athletic Beauty»), eine Hommage, die in zwölf Sprachen übersetzt wurde. In seinem jüngsten Buch «Crowds – Das Stadion als Ritual von Intensität» besingt er das orgiastische Gefühl beim Stadionbesuch. Gumbrecht ist involviert beim College-Footballteam von Stanford, Fan von Borussia Dortmund, besitzt seit 1991 eine Saisonkarte im Eishockey bei den San Jose Sharks und ist entzückt von der Anmut Roger Federers. Seit 2000 US-Bürger, lebt er in Palo Alto im Silicon Valley, ist in zweiter Ehe «sehr glücklich» verheiratet und hat vier Kinder und zwei Enkel. Alle viel bessere Sportler als er selbst, wie er sagt. Obschon er, das darf nicht verschwiegen werden, jeden Morgen 19 Minuten den Unterarmstütz hält, bis alles schmerzt. Im Interview spricht er über seine Bewunderung für Roger Federer, dessen globale Ausstrahlung und Stellung in der Sportwelt.
Sie verfassten mit Ihrem Werk «Lob des Sports» eine Hymne auf die Schönheit und Faszination des Sports. Schon 2006 erwähnten Sie da Roger Federer, hoben Sie seine Eleganz und Mühelosigkeit hervor. Wodurch fasziniert er Sie?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Roger Federer»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Roger Federer» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Roger Federer» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.