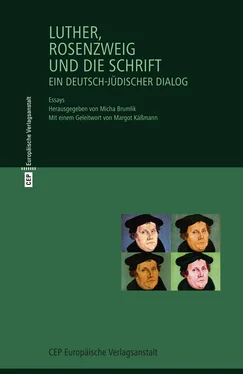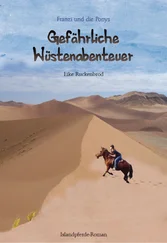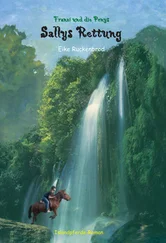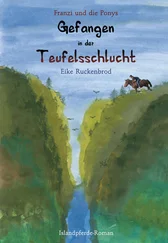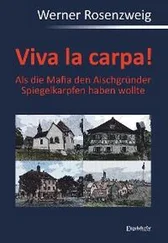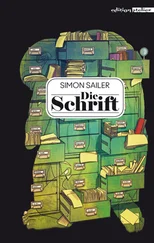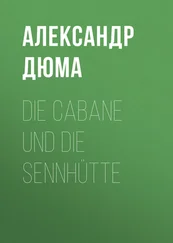Das sind die Zeiträume dieses Buchs. Ich sagte zu Anfang, daß alles Sprechen Übersetzen sei. Das Gespräch der Menschheit hat mit diesem Buch angehoben. In diesem Gespräch liegen zwischen Rede und Widerrede halbe, ganze Jahrtausende. Der Frage des dritten Kapitels der Genesis suchte Paulus die Antwort, indem er die Worte des zwanzigsten Kapitels des Exodus in Frage stellte. Seine Antwort wurde von Augustin und Luther wiederholt, doch auf sein Infragestellen gaben die beiden jeder wieder eine eigene Antwort, jener die Antwort seines Gottesstaats, dieser die Antwort seines Schreibens an die Ratsherrn, daß sie christliche Schulen aufrichten sollten. Jedesmal steht vor dem neuen Satz des Gesprächs eine Übersetzung. Die Übersetzung in die Sprache der Tragödie, die Übersetzung in die Sprache des Corpus Juris, die Übersetzung in die Sprache der Phänomenologie des Geistes. Wann das Gespräch zuende sein wird, weiß kein Mensch; es hat auch niemand gewußt, wann es anhub. So kann ihm auch keines Menschen Unwille, Besserwissen und Wohlweisheit sein Ende setzen, sondern allein der Wille, das Wissen, die Weisheit dessen, der es angehoben hat.
Anmerkungen
1Sämliche Werke III, II, S. 218.
2Vorrede über das Buch Hiob (Drucke von 1524 und 25).
3Luther spricht vom 68. Psalm.
4Vorrede zum Deutschen Psalter.
5Zit. nach Hopf. Würdigung der Lutherschen Bibelübersetzung, S. 126.
6Vollständige Darstellung und Beurteilung der deutschen Sprache in Luthers Bibelübersetzung. 1794 und 95.
7Für die Cansteinsche ist das neuerdings ausführlich dargestellt von Burdach (Die nationale Aneignung der Bibel und die Anfänge der germanischen Philologie. 1924).
8Gött. Gel. Anz. 1885.
9Das Neue Testament von 1522 kostete anderthalb Gulden, „soviel wie ein Pferd“.
10Vorrede zum Deutschen Psalter.
11Vorrede über das Buch Hiob (1524 und 25).
12Cochläus und Dietenberger (bei Hopf a. a. O., S. 132 ff.).
13Emser und Eck (bei Hopf a. a. O., S. 172).
14Cochläus (bei Hopf a. a. O., S. 132).
15Eck in der Vorrede zu seinem auf Befehl der bayrischen Herzöge hergestellten Konkurrenzunternehmen (bei Hopf a. a. O., S. 134).
16Cochläus (bei Hopf a. a. O., S. 132).
17Vorwort zur „Textbibel“.
18Vorwort der großen Ausgabe, wiederangeführt im Vorwort zur Textbibel.
19Ich zitiere nach der Neubearbeitung des Hauptwerks von 1922, weil eine Neubearbeitung der Textbibel noch nicht vorliegt; nur für die Stellen, wo das große Werk wegen angenommener Textverderbnis nicht zu übersetzen wagt, lege ich die hierin mutigere Textbibel zugrunde. Auch das Hauptwerk wendet sich ja an das große Publikum; und die Neubearbeitung pflastert ihren Weg mit guten Vorwortsätzen von „Angleichung an den Urtext, die auch vor dem den hebräischen Sprachcharakter kennzeichnenden starken sinnlichen Realismus nicht zurückschreckt“ und macht dem dernier cri von 1922, der „lebendigen Wissenschaft“, das charakteristisch formulierte Versprechen, „unschöne Wendungen zu bessern, überhaupt die Wiedergabe nicht nur photographisch exakt, sondern bildmäßig lebendig zu gestalten, um sie dem Ideal eines künstlerisch vollwertigen Abbildes des Originals in etwas näherzubringen“. Wen bei dem Wort lebendige Wissenschaft, diesem Produkt der Galgenreue, eine Gänsehaut überläuft, der wird freilich sagen, daß ihm eine gute Photographie lieber ist als ein schlechtes Bild. Es kommt beim Übersetzen nur und ausschließlich auf die „Exaktheit“ an, das „Künstlerische“ braucht man nicht zu bemühen.
20Dazu und zum ganzen Zelt vgl. das Buch „Der Pentateuch“ von B. Jacob, unter den Lebenden, Juden wie Christen, wohl dem besten Kenner der hebräischen Bibel.
21Vgl. etwa für die Frühzeit, 1514, die Äußerung, die den hebräischen Text für den Buchstaben erklärt und den lateinischen für den Geist (zit. bei Scheel, Martin Luther II, 228 u. 408); für die Spätzeit die bekannte Mathesiussche Schilderung Luthers beim Revidieren der Übersetzung: „mit seinen alten lateinischen und seinen neuen teutschen Biblien, dabei er auch stetigs den hebräischen Text hatte“.
22Die Kreatur, 1. Jahrgang, Heft 1: „Die Schrift und das Wort“.
23Um „Dritten Teil des Alten Testaments“ 1524 und 25.
24Nachwort zu Jehuda Halevi.
Walter Homolka
Martin Luther als Symbol geistiger Freiheit? Der Reformator und seine Rezeption im Judentum
„Wer immer aus irgendwelchen Motiven gegen die Juden schreibt, glaubt das Recht zu besitzen, triumphierend auf Luther zu verweisen“, befand vor gut einhundert Jahren der junge Rabbiner Reinhold Lewin (1888−1943). 1Als 1911 seine preisgekrönte Inaugural-Dissertation „Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters“ erschien, war dies die überhaupt erste wissenschaftliche Monographie zu diesem Thema, die auf der Durchsicht aller Schriften des Reformators beruhte. Lewin machte in seiner Arbeit das Schwinden von Luthers Konversionshoffnung für dessen Abkehr von seiner anfänglich toleranten Haltung gegenüber den Juden verantwortlich. 2
Martin Luther ist Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Legitimationsfigur des Antisemitismus geworden. Es gab aber schon zu Lebzeiten des Reformators auch jüdische Stimmen zu seinem Wirken und zu seiner Wirkung; Andreas Pangritz hat diese frühe Rezeptionsgeschichte ausführlich geschildert. 3Als eine der ersten jüdischen Reaktionen gilt die des aus Spanien stammenden Jerusalemer Kabbalisten Rabbi Abraham ben Elieser Halevi (ca. 1460−1528), der in einem Brief von 1525 Luther als denjenigen beschrieb, der die Christen zum wahren Glauben zurückbringen würde, also als Wegbereiter des Messias. 4
Auch wenn diese messianischen Hoffnungen enttäuscht wurden und die anfängliche Sympathie bald schwand: Luther hatte mit seiner Schrift „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“ (1523) eine unerhört neue Position vertreten. 5Als er sich zunächst in die Lage der Juden in Europa versetzte und schrieb: „Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte gesehen, dass solche Tölpel und Knebel den christlichen Glauben regieren und lehren, so wäre ich eher eine Sau als ein Christ geworden“, da weckte das bei den Juden in den deutschsprachigen Ländern zunächst große Hoffnungen auf eine Verbesserung ihrer Lage: „Das war ein Wort, wie es die Juden seit einem Jahrtausend nicht gehört hatten“, urteilte Heinrich Graetz. 6Doch dann empfand Luther das Festhalten der Juden an ihrem Glauben als Infragestellung seines eigenen Glaubensangebots, was später mit zu seinen starken Ausfällen gegen ihre „Verstocktheit“ führte, so zu seiner Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ von 1543. 7Noch im selben Jahr fand eine umfassende Vertreibung aus dem Kurfürstentum Sachsen statt, wo die harte Einstellung des Reformators gegenüber den Juden dominierte; bei der Vertreibung aus dem lutherischen Braunschweig berief sich der Stadtrat 1546 ebenfalls auf Luthers Judenschriften. Zuvor hatte als erster protestantischer Landesherr der hessische Landgraf Philipp „der Großmütige“ das jüdische Leben mit einer Judenordnung reglementiert. Rabbiner Abraham Geiger (1810−1874) kommentierte die Wirkung des Reformators folgendermaßen: „So darf es uns denn auch nicht befremden, wenn das befreiende Reformationswerk in seiner Heimstätte sich sehr bald zur dogmatischen Formel verengt, daß wir fast glauben müssen, es sei hier keine Befreiung vor sich gegangen, sondern nur Fessel mit Fessel vertauscht worden, das Volksleben sei nicht erfrischt worden, vielmehr habe ein kleinlicher Geist dasselbe verunreinigt und zerfleischt.“ 8
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Luther im Zuge der jüdischen Aufklärung zum Symbol und Ausgangspunkt geistiger Freiheit. Jüdische Reformer wie Saul Ascher (1767−1822) begriffen ihn als Wegbereiter für Emanzipation und Erneuerung des Judentums. 9Die jüdische Luther-Verehrung erinnert damit sehr an die Begeisterung für Friedrich Schiller. 10Dorothea Wendebourg hat auf den Umstand hingewiesen, dass die judenfeindlichen Schriften des späten Luthers bis zu ihrem Nachdruck in der 1826 begonnenen Erlanger Gesamtausgabe offensichtlich nicht bekannt waren. 11Auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fielen seine gehässigen Ausfälle kaum ins Gewicht, wenngleich der Leipziger Pastor Ludwig Fischer 1838 Luthers Schriften über Juden von 1523 und 1543 veröffentlicht hatte um die Notwendigkeit einer „freundlichen“ Judenmission gegenüber der „erstarrten“ lutherischen Orthodoxie zu begründen. 12
Читать дальше