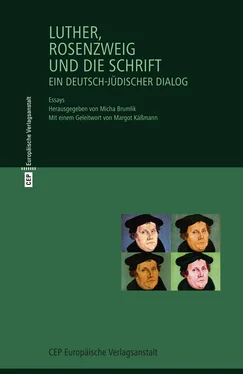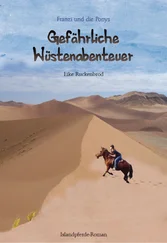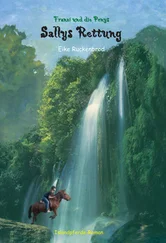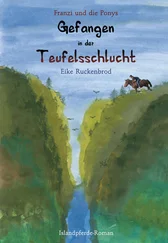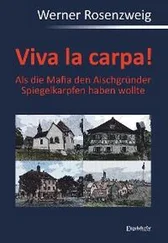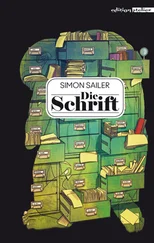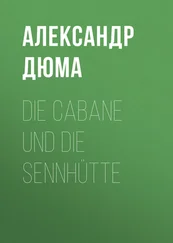Die neuzeitliche Beschäftigung des Judentums mit dem Christentum ist eng mit den Rabbinern Abraham Geiger und Leo Baeck verbunden. So wie schon Abraham Geigers Beschäftigung mit dem jüdischen Jesus und mit dem Christentum der Entwurf einer Gegengeschichte gewesen war, so hatte auch Rabbiner Leo Baeck (1873−1956) sein Wesen des Judentums (1905) als Gegengeschichte angelegt. Gerade die „Zwei-Reiche-Lehre“ Luthers, die das Leben in einen politisch-gesellschaftlichen und einen religiösen Bereich zu trennen scheint, ist für Leo Baeck eine zentrale Säule seiner Kritik am Luthertum. 32Der Mensch werde ganz passiv beschrieben, der Gnade und Erlösung bedürftig und somit unfähig, die Welt aktiv nach Gottes Wollen zu gestalten. 33Neben dem Menschenbild war es aber die enge Verbindung von Thron und Altar, die Baeck Martin Luther zuschrieb. 1926 stellte er gegenüber Rabbiner Caesar Seligmann (1860−1950) fest: „Es ist ein geistiges und moralisches Unglück Deutschlands, daß … man aus dem Deutschtum eine Religion gemacht hat. Anstatt an Gott zu glauben, glauben sie – lutherische Pfarrer voran – an das Deutschtum“. 34Durch seine Bindung an den Staat habe es das Luthertum versäumt, zum Träger einer universalen Botschaft zu werden. Es habe die Chance, Weltreligion zu sein, nicht wahrgenommen. Die absolute Unabhängigkeit der Religion vom Staat war dabei für Baeck von höchster Bedeutung. Die lutherische Reformation aber habe die Religion an den Staat ausgeliefert. Arnold Zweig (1887−1968) sprach in diesem Zusammenhang sogar davon, dass „Luther in der Vergottung des Staates durch die Identität von oberstem Bischof und Landesherrn zur Vernichtung seiner eignen reformatorischen Tat aus Gründen der Politik das letzte Wort“ gesprochen hatte. 35
Leo Baeck gewahrte hier Tendenzen, die für den autoritären Staat wegbereitend waren und die die schweigende Billigung des Nationalsozialismus durch die Mehrheit der Bürger förderten. In einem Polizeistaat, der keinerlei Raum mehr für die persönliche Entscheidung lässt, sah er den direkten Abkömmling des Luthertums. Der nationalsozialistische Staat war ihm somit die logische Konsequenz einer fehlgeleiteten theologischen Evolution. Kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten stellte Leo Baeck 1932 in Zwischen Wittenberg und Rom schließlich fest: „Es ist ein Mangel im Protestantismus, dass er, der dem Volk die Bibel gegeben hat, dann die Bibel, die im Leben oder gar nicht sein will, zum bloßen Predigt- und Andachtsbuch gemacht hat.“ […] „Die gerade im Protestantismus so häufige Ablehnung des Alten Testaments, dieses eifervollen Buchs, geht wohl nicht am wenigsten auf eine Ablehnung dieses Gebotes zurück, auf die altestamentliche Deutlichkeit von: ‚Ich bin der Ewige, Dein Gott, Du sollst!‘“. 36Nach der Machtergreifung konstatierte Baeck dann im Oktober 1933 in Das Judentum in der Gegenwart: „Innerhalb des deutschen Protestantismus hat sich vielfach gegenüber den Fragen, die sich aus der Beschaffenheit, den Beständen und Zuständen dieser Welt ergeben, eine neue Art der theologischen Beantwortung durchgesetzt, die von einem Glauben an ‚Schöpfungsordnungen’ ausgehen will und sich hierfür, sei es mit Recht oder Unrecht, auf die Lehre Luthers beruft“. 37
Mit Luthers 450. Geburtstag 1933 setzte eine Rückbesinnung auf den Reformator unter nationalsozialistischen Gesichtspunkten ein. Ludwig Feuchtwanger (1885−1947), ein Bruder der Schriftstellers Lion Feuchtwanger, bemerkte zu diesem Luthergeburtstag: „Wie damals Martin Luther gegen die Juden losbrach, so tönt es immer wieder aus dem deutschen Volk seit 450 Jahren. Wir erleben im November 1933, dass zahlreiche bedeutende Vertreter der protestantischen Kirche und Lehre sich dieser Stellung Luthers ausdrücklich zu eigen, ihm Wort für Wort nachsprechen und seine Judenschriften eindringlich zitieren und empfehlen“. 38
Es überrascht nicht, dass fünf Jahre später der Thüringer Landesbischof Martin Sasse (1890−1942) die Novemberpogrome mit Luthers Judenschriften rechtfertigt: „Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen.… In dieser Stunde muß die Stimme des Mannes gehört werden, der … der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der Warner seines Volkes wider die Juden“. 39Sicherlich führt keine direkte Linie von Luthers Judenschriften zu Hitler und zur Schoa. Eine Linie lässt sich allerdings ziehen, und sie ist tragisch: Rabbiner Reinhold Lewin, Verfasser der ersten jüdischen Monographie über „Luthers Stellung zu den Juden“, wurde im März 1943 mit seiner Frau Evie und zwei Kindern von Breslau nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Heute, im 500. Jahr der Reformation, bleibt die Frage, ob die evangelische Theologie und die protestantischen Kirchen sich von Martin Luther distanzieren und tatsächlich von Jesus von Nazareth sprechen können, ohne wie der Reformator das Judentum als defizitär herabzusetzen und das Andauern des Bundes Gottes mit dem jüdischen Volk in Zweifel zu ziehen. 40
Anmerkungen
1Reinhold Lewin: Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters, Berlin 1911, S. 110.
2Ebd., S. 37ff.
3Andreas Pangritz: Zeitgenössische jüdische Reaktionen auf Luther und die Wittenberger Reformation, in: Begegnungen. Zeitschrift für Kirche und Judentum, Nr. 1 / 2011, S. 2–9.
4Gershom Scholem hat den Brief erstmals in Kirjat Sepher 7 (1930/31), S. 444f, veröffentlicht.
5D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd. 11, S. 307ff.
6Heinrich Graetz: Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Bd. 9, Leipzig 1907, S. 189.
7D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd. 53, S. 417ff.
8Abraham Geiger: Das Judentum in seiner Geschichte, Breslau 1910, S. 522.
9Saul Ascher: Leviathan oder Ueber Religion in Rücksicht des Judenthums, Berlin 1792.
10Vgl. Andreas B. Kilcher: Geteilte Freude. Schiller-Rezeption in der jüdischen Moderne, München 2007.
11Dorothea Wendebourg: Jüdisches Luthergedenken im 19. Jahrhundert, in: Mazel tov. Interdisziplinäre Beiträge zum Verhältnis von Christentum und Judentum (=Studien zu Kirche und Israel, Neue Folge, Bd. 1), hg. von Tanja Pilger / Markus Witte, Leipzig 2012, S. 195−213.
12Ludwig Fischer: D. Martin Luther, von den Juden und ihren Lügen, ein crystallisirter Auszug aus dessen Schriften über der Juden Verblendung, Jammer, Bekehrung und Zukunft, ein Beitrag zur Charakteristik dieses Volks, Leipzig 1838.
13Vgl. Ludwig Philippson: Moses Mendelssohns providentielle Sendung, in: Lessing-Mendelssohn-Gedenkbuch, hg. vom Deutsch-Israelitischen Gemeindebund, Leipzig 1879, S. 84–100.
14Heinrich Heine: Sämtliche Schriften, hg. von Klaus Briegleb, Bd. III: Schriften 1831, München 1971, S. 583.
15Ludwig Philippson: Zur Herstellung und Verbreitung wohlfeiler Bibeln, in: Allgemeine Zeitung des Judenthums, 23. Jg., Heft 13 (21.03.1859), S. 184.
16Leopold Zunz: Die synagogale Poesie des Mittelalters, Frankfurt am Main 1920, S. 334.
17Abraham Geiger: Das Judentum und seine Geschichte. Breslau 1910, S. 519.
18Ebd., S. 520.
19Ebd., S. 521.
20Ludwig Geiger (Hg): Abraham Geiger. Leben und Lebenswerk, Berlin 1910, S. 162f.
21Abraham Geiger: Das Judentum und seine Geschichte. Breslau 1910, S. 519
22Vgl. Hans-Jürgen Benedict: „Ruhm dem Luther!“ Heinrich Heines Lutherdarstellung zur Lektüre empfohlen, in: Pastoraltheologie, Bd. 105, Ausgabe 4 (2016), S. 219–230.
23Heinrich Heine: Sämtliche Schriften, hg. von Klaus Briegleb, Bd. III: Schriften 1831, München 1971, S. 585.
24Ebd., S. 538.
25Ludwig Börne: Sämtliche Schriften, hg. von Inge und Peter Rippmann, Bd. 3, Düsseldorf 1964, S. 924.
Читать дальше