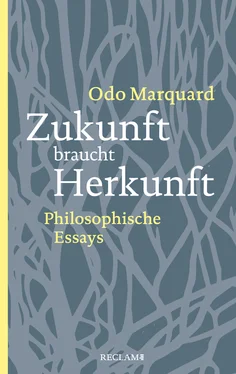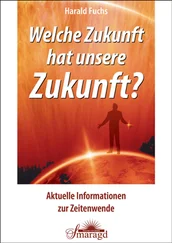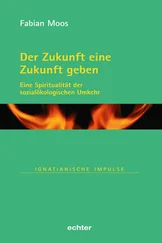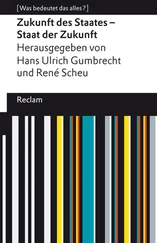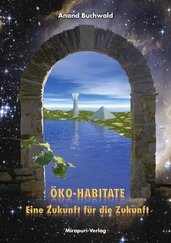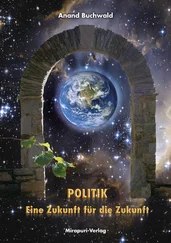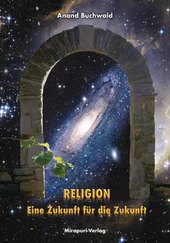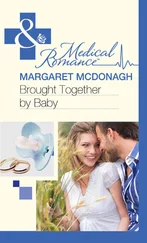Dies alles gehört in eine autobiographische Einleitung, weil es sich auch auf Introspektion stützt: auf eine Analyse des eigenen Mitmachverhaltens in den 60er-Jahren und seiner Umkehr in die Absage, in die Weigerungsverweigerung. Dazu gehört dann auch die Vermutung, dass diese Absage bei mir – einsetzend 1967: ich merke spät und habe lange Bremswege – erleichtert war durch die – gegenüber der frühen ›bloßen‹ Skepsis – nunmehr nachgeholte Konkretisierung. Denn inzwischen war bei mir der Schritt von der »Präexistenz« in die »Existenz«20 getan, der Schritt: zu heiraten (1960) und Vater zu werden, statt entlarvungsartistisch in Dauerreflexion zu verharren; die institutionelle Notwendigkeit der Habilitation endlich zu erfüllen (1963) und die Berufspflichten des akademischen Lehrers auf mich zu nehmen: als Privatdozent in Münster und ab 1965 in Gießen als Seminardirektor und als ordentlicher Professor und später – nach der Hochschulreform – als nicht mehr ganz so ordentlicher; schließlich als Dekan und seither unvermeidlich auch in mancherlei Funktionen der Wissenschaftsverwaltung, der Schul- und Hochschulpolitik, vor denen ich mich nicht gedrückt habe. Im Übrigen galt dann, was in Gides Falschmünzern Armand über seine Familie sagte: »Wir leben von Papas Glauben«, in abgewandelter Form auch von der meinen: Sie lebte von Papas Zweifeln und Verzweiflungen und seinem Talent, dieses Betriebskapital maßvoll mit Gelehrsamkeit vollzusaugen und in didaktische und transzendentalbelletristische Formulierungen umzusetzen, und sie lebte davon auf die Dauer – nach dem zweiten Ruf – nicht einmal schlecht. Sie hätte noch weit besser leben können, wenn ich dieses Betriebskapital nun auch noch durch ein Sortiment von revolutionären Gesinnungen und entsprechenden Theorien dauerhaft aufgestockt und arrondiert hätte; indes: dann hätte auch bei mir jene Diastase ein bestimmtes Spannungsquantum überschritten, die für diese ganze Phase bestimmend war: dass nämlich Reflexionswelt und Lebenswelt, Erwartungswelt und Erfahrungswelt, Gesinnungswelt und Verantwortungswelt, Reformwelt und Arbeitswelt, Resolutionswelt und Handlungswelt, Empörungswelt und glaubwürdige Welt auseinander traten und beziehungslos wurden zueinander.
3. Skepsis und Endlichkeit . Die Undurchhaltbarkeit dieser Diskrepanz – meine ich – führte zu dem, was man »Tendenzwende« genannt hat: sie war die fällige Verehrlichung der Verhältnisse. Denn es gibt das Recht der nächsten Dinge gegenüber den letzten.
Zu dieser neuen Ernüchterung gehörte der Katzenjammer in Bezug auf den Illusionsgehalt des nachträglichen Ungehorsams: mich jedenfalls wurmte es, dass mich gerade die Skepsis zu einer neuen Vertrauensseligkeit geführt hatte. Es scheint – unbehaglicherweise – so etwas zu geben wie ein Gesetz der Erhaltung der Naivität: Die menschliche Misstrauenskapazität ist begrenzt, und je mehr man sie an einer der Denkfronten konzentriert, desto leichter kommt die Naivität zum Sieg an den anderen. Die Gegenwartsszene ist bewegt von Gegenbesetzungen gegen diese unbehagliche Erfahrung; darüber – zum Beispiel – wurden unsere Dichter zu kochenden Seelen: sie kochen fast alle, entweder vor Wut oder am Herd (oder beides), und allemal gibt das Bücher. Ich selbst kann nicht kochen, es sei denn auch nur mit Wasser; aber sogar das – tristesse oblige! – gab ein Buch: die Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie (1973), die hier eine Zwischenbilanz versuchten. Die Philosophie – das gilt für die des nachträglichen Ungehorsams wie für die Zweifelsorgien der bloßen Skepsis – ist kein Amulett, das gegen Irrwege schützt; das nahm ich ihr übel, und aus dieser Enttäuschung heraus entstand der hier secundo loco abgedruckte – 1973 zum 60. Geburtstag von Hermann Krings geschriebene – Aufsatz »Inkompetenzkompensationskompetenz?«, der natürlich die Skepsis gegenüber der Philosophie übertrieb: aber gerade das ließ ihn mitrepräsentativ sein für jene spezifisch deutsche »Selbstunsicherheit der Philosophie«21 und Verzweiflung an ihr, die – historisch bedingt – eine umgekippte Überhoffnung ist. Denn die »verspätete Nation« – das hat Plessner dargelegt – kompensiert ihr verspätungsbedingtes Defizit an politischen Liberalwirklichkeiten zunächst durch Übererwartung an die Geisteskultur, speziell an die Philosophie. Doch diese Übererwartung kann die Philosophie (wie ihr Weg durchs 19. Jahrhundert zeigt, auf dem gerade darum die Kunst der Enttäuschung entstand: die Ideologiekritik) nur enttäuschen: Das erzwang – anders als etwa in den angelsächsischen Demokratien, deren Ansprüche an die Philosophie von vornherein bescheidener sein konnten – gerade in Deutschland die Neigung, die absolute Hoffnung auf die Philosophie schließlich durch die absolute Verzweiflung an der Philosophie zu ersetzen. Das tat auch mein Aufsatz über die »Inkompetenzkompensationskompetenz« der Philosophie. Im Grunde aber wollte er für die Philosophie nur das Ende der Unbescheidenheit22: in diesem Sinne wiederholte und bekräftigte er die Wende zur Skepsis.
Gerade diese Wende zur Skepsis jedoch – wiederholt und bekräftigt – musste skeptischer werden in Bezug auf sich selber: insbesondere angesichts des unbehaglichen Verdachts, sie wirke als indirekte Ermächtigung von Weltverbesserungsillusionen. Darum wurde es fällig, ihr Illusionspotential zu reduzieren: das Quantum quasigöttlicher Souveränität, das der Dauerzweifel zu enthalten scheint, an die Kette der Menschlichkeit zu legen und die Skepsis (meinethalben durch »existenzialistische« Akzentuierung) umzudefinieren zu einer Philosophie der Endlichkeit .
Darum wurden jetzt gleichwichtig mit dem Zweifel jene Züge, die die Skepsis – historisch belegbar – stets auch gehabt hat: die Ernstnahme des »Einzelnen« und die Bereitschaft, gemäß den »Sitten der Väter« zu leben, d. h. – wo es keine zwingenden Gründe fürs Abweichen gibt – nach Üblichkeiten zu handeln. Das ist für Menschen unausweichlich, weil sie Einzelne sind. Die Skepsis wünscht sich zwar den vermeidlichen Einzelnen: die gebildete Individualität. Aber sie rechnet mit dem unvermeidlichen Einzelnen: das ist jeder Mensch, weil er »unvertretbar« sterben muss und »zum Tode« ist.23 Dadurch ist das Leben des Menschen stets zu kurz, um sich von dem, was er schon ist, in beliebigem Umfang durch Ändern zu lösen: er hat schlichtweg keine Zeit dazu. Darum muss er stets überwiegend das bleiben, was er geschichtlich schon war: er muss »anknüpfen«. Zukunft braucht Herkunft: »die Wahl, die ich bin«24, wird »getragen« durch die Nichtwahl, die ich bin; und diese ist für uns stets so sehr das meiste, dass es – wegen unserer Lebenskürze – auch unsere Begründungskapazität übersteigt: Darum muss man, wenn man – unter den Zeitnotbedingungen unserer vita brevis – überhaupt begründen will, nicht die Nichtwahl begründen, sondern die Wahl (die Veränderung): die Beweislast hat der Veränderer. Indem sie diese Regel25 übernimmt, die aus der menschlichen Sterblichkeit folgt, tendiert die Skepsis zum Konservativen. »Konservativ« ist dabei ein ganz und gar unemphatischer Begriff, den man sich am besten von Chirurgen erläutern lässt, wenn diese überlegen, ob »konservativ« behandelt werden könne, oder ob die Niere, der Zahn, der Arm oder Darm herausmüsse: lege artis schneidet man nur, wenn man muss (wenn zwingende Gründe vorliegen), sonst nicht, und nie alles; es gibt keine Operation ohne konservative Behandlung: denn man kann aus einem Menschen nicht den ganzen Menschen herausschneiden. Das – unabsichtlich oder nicht – übersehen die, die den Begriff des Konservativen perhorreszieren. Analog lässt sich nicht alles ändern und darum nicht jegliches Nichtändern unter Anklage stellen: Deswegen bewirken die, die das – von den Geschichtsphilosophen bis zu den Diskursphilosophen – im Sinne einer »Übertribunalisierung der Wirklichkeit« tun, etwas anderes, als sie wollen. Das habe ich (mit Blick auf die Anfangskonstellation dieses Zusammenhangs) in dem 1978 geschriebenen Aufsatz »Der angeklagte und der entlastete Mensch in der Philosophie des 18. Jahrhunderts« darlegen wollen, der hier tertio loco abgedruckt ist: Die Übertribunalisierer etablieren nicht die absolute Rationalität, sondern den »Ausbruch in die Unbelangbarkeit«, der für Freiheiten eintritt, die wir – vor aller prinzipiellen Erlaubnis – schon sind; dazu gehören Üblichkeiten. Weil wir zu schnell sterben für totale Änderungen und totale Begründungen, brauchen wir Üblichkeiten: auch jene Üblichkeit, die die Philosophie ist. Die Skeptiker rechnen also mit der sterblichkeitsbedingten Unvermeidlichkeit von Traditionen; und was dort – üblicherweise und mit dem Status von Üblichkeiten26 – gewusst wird, wissen auch sie. Die Skeptiker sind also gar nicht die, die prinzipiell nichts wissen; sie wissen nur nichts Prinzipielles: die Skepsis ist nicht die Apotheose der Ratlosigkeit, sondern nur der Abschied vom Prinzipiellen .
Читать дальше