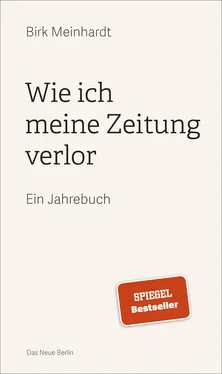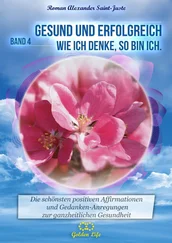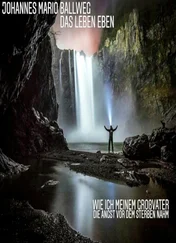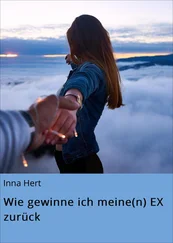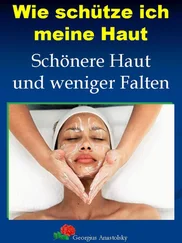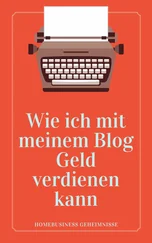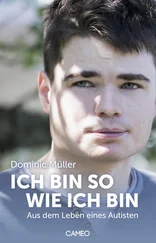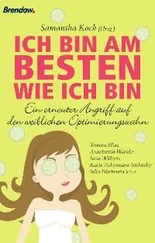1995
Es hat sich gelegt, das Vorsichtige. Ich bin hier angekommen, habe die Macht über mich erlangt. Manchmal übe ich auch ein bißchen Macht aus; es ergibt sich so, daß ich in unserem Großraum mit jemandem auf Russisch telefonieren muß, nur eine Absprache, mein Russisch ist lausig, unzureichend für Interviews, aber für sowas Alltagskurzes reicht’s. Als die Kollegen die für sie ungewohnten Töne hören, strömen sie herbei, bilden eine Traube an meinem Tresen und lauschen, ich möchte nicht sagen ergriffen, aber beeindruckt. War das Russisch? fragen sie, kaum daß ich aufgelegt habe, das war jetzt Russisch, oder? Leider nur rudimentäres, müßte ich antworten. Aber sie sind so ehrfurchtsvoll in dem Moment, so glücklich wie kleine Kinder, denen direkt vor der Nase irgendein Instrument gespielt worden ist, welches sie höchstens aus dem Fernsehen kennen, daß ich sie nicht enttäuschen mag und nur kurz und möglichst gelassen nicke. Zugleich, ebenfalls im Bruchteil einer Sekunde, richte ich den Daumen meiner auf dem Tisch ruhenden Hand auf und lasse ihn wieder fallen, ah, wie sich doch eben Bescheidenheit und Bestimmtheit aufs Perfekteste verbunden haben, und fast ohne mein Zutun, erstaunlich, wie einfach alles geht.
Was kostet die Welt, einmal spiele ich mich doch sehr auf. Es geschieht während der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften, und es trifft einen Hünen, der in seiner Disziplin gerade Zweiter geworden ist. Sein größter Erfolg bis jetzt, damit darf er erstmals zu den Weltmeisterschaften fahren, glücklich sitzt er vor uns Journalisten und wartet auf Fragen; war er im Frühjahr, in trunkenem Zustand, nicht unangenehm im Trainingslager aufgefallen? War da nicht irgendwelches Mobiliar aus dem Fenster geflogen? Steht der Mann nicht sogar im Ruch, irgendwie rechts zu stehen? So sprach man zuletzt hinter vorgehaltener Hand, so deutete man es an im Kreise der anderen Athleten seiner Sparte, darum nun mal Butter bei die Fische, diese Sache im Trainingslager, von der man spricht, und überhaupt Ihr ganzes Verhalten, was sagen Sie eigentlich zu der und zu dem?
Eben, zu Beginn der Pressekonferenz, hatte ich noch keinen Gedanken an jene Gerüchte verschwendet, und jetzt war der Gedanke, in Frageform, plötzlich hervorgebrochen, der Hüne versteinert. Er mag gar nicht reden. Er bekommt auch nur noch eine Höflichkeitsfrage gestellt, und ich, der ich im Kollegenkreise nun wahrlich nicht als Haudrauf gelte, bekomme verwirrte Blicke zugeworfen, was war denn das gerade? Weiß ich auch nicht. Will ich aber gleich wiedergutmachen. Ich laufe dem stumm sich entfernenden Mann nach und sage ihm, es sei nicht meine Absicht gewesen, ihm in dieser Stunde diese Frage zu stellen, es tue mir leid. Er nickt. Er ist erkennbar nicht in der Verfassung, mich zurückzufragen, was zum Teufel denn dann meine Absicht gewesen sei, so komme ich davon, ich habe mich entschuldigt, und er hat genickt, nun habe ich noch ein dumpfes Gefühl im Magen, stärker als Flauheit und schwächer als Brechreiz, aber das wird vergehen, drinnen im Stadion läuft ja schon der nächste Wettkampf.
Mittsommerzeit jetzt. Das Tennisturnier in Wimbledon beginnt. Mein Chef ruft mich abends zu Hause an und sagt, ich will Ihnen nur sagen, wir haben Ihren Text kurz vorm Andruck aus dem Blatt genommen, wir fanden ihn nicht recht passend. Den Text, der auf einer Themenseite zum zehnjährigen Jubiläum des Sieges des 17jährigen Leimeners stand und der beinhaltete beziehungsweise beinhalten sollte, wie jener Triumph damals von den Menschen im Osten aufgenommen worden war; der rausgeschmissene Artikel trug die Überschrift »Wahrscheinlich spielt er nicht schlechter als Emmrich« und ging wie folgt:
Zufälligerweise sind die beiden größten Tennisturniere der DDR kurz vor beziehungsweise zur Wimbledonzeit gewesen. Im Ostseebad Zinnowitz haben sie die Ergebnisse aus London immer mit Reißzwecken an eine uralte Eiche gepinnt, was besonders deshalb nötig war, weil man da oben das Westfernsehen nur schlecht empfangen konnte. Meistens hat Thomas Emmrich aus Magdeburg das Turnier gewonnen und auch das andere in Friedrichshagen, im Osten von Ostberlin.
Nach Friedrichshagen habe ich, quer durch den Wald, von meiner Wohnung mit dem Fahrrad nur zehn Minuten gebraucht, und deshalb hat meine damalige Zeitung, die mit Tennis ebensowenig am Hut hatte wie ich, mich einmal dorthin geschickt. Ich deponierte den Notizblock auf dem Gepäckständer und hätte mir gut vorstellen können, den Tag bei richtigem Sport zu verbringen, Leichtathletik etwa.
Emmrich war sehr freundlich. Eigentlich muß er permanent sauer gewesen sein, daß er nie in den Westen durfte, aber entweder hatte er ein stoisches Gemüt, oder er verbarg sein Gefühl. Ich kam nicht auf die Idee, ihn danach zu fragen. Und er erwartete keine solche Frage. Es war eine der vielen stillen Vereinbarungen im Lande. Deshalb weiß ich bis heute nicht, ob Emmrich meint, aus ihm wäre ein Becker geworden, wenn man ihn nur gelassen hätte. Natürlich, sagen manche; der Emmrich hätte doch den Becker weggeputzt. Vielleicht hilft es ihnen.
Vor zehn Jahren, als Becker auf dem Durchmarsch war, habe ich eine Reportage über Mütter im Leistungssport geschrieben. Ich fand das Thema passend, denn es war Sauregurkenzeit. Die meisten Leute, für die ich schrieb, verhielten sich ebenfalls ruhig. Es war nicht so, daß sie am Abend des 7. Juli schwarz-rot-goldene Fahnen mit nichts drauf aus dem Fenster gehängt hätten. Manchmal taten sie das nach Fußballspielen, und ich fand schlichtweg, das war Verrat. Ich neigte mehr zum Anfeuern der DDR-Teams. »Neiiiin, Engel, du Idioooot«, habe ich als Kind einmal aus Leibeskräften gebrüllt, als meine Handballer gegen die bundesdeutschen um die Olympiaqualifikation spielten. Hans Engel aus Frankfurt an der Oder verballerte damals den entscheidenden Siebenmeter. Später, als Journalist, traf ich ihn manchmal, und es kam mir immer vor, als schaute er traurig. Er war die personifizierte Niederlage gegen den Klassenfeind.
Beim Aufräumen im Keller fand ich jetzt eine vergilbte Broschüre: Leistungssport im imperialistischen Westdeutschland. Ich erinnere mich, sie als 13, 14jähriger Mittelstreckenläufer bekommen zu haben. Darin stehen Sätze wie dieser: »Die auf die sportpolitische Wirksamkeit und auf sportliche Siege zielende Ideologierelevanz ist ein Hauptaspekt der Olympiavorbereitung, um westdeutsche Spitzensportler durch antikommunistische Verhetzung zu personifizierten Gegnern des Sozialismus zu erziehen.« Ich fand das leicht verquast, aber etwas, meinte ich, würde schon dran sein. Bis ich den ersten Berühmten traf, der verhetzt gewesen sein müßte. Es war Bernd Schuster, damals Barcelona. Er erzählte von Zwickauer Verwandten, die er zuweilen besuche, und machte nicht den Eindruck, als hasse er den Sozialismus oder gar mich. Mein Artikel über ihn wurde nicht gedruckt. Boris Becker, will ich damit nur sagen, mußte nicht mehr viel tun. Ich hatte nichts gegen ihn.
Eine Zeitlang dachte ich, er sei mir egal. In Wirklichkeit war er zu unberechenbar, also zu interessant, als daß er mich kalt gelassen hätte. Es wurde mir in dem Moment bewußt, als ein Leser anrief und berichtete, Becker sei mit seiner Freundin Karen zu Besuch bei deren Oma in Liebsdorf, Kreis Luckau, Bezirk Cottbus, und der Chefredakteur meinen Schreibtischnachbarn aufforderte, sofort dorthin zu düsen. Ich spürte Neid, daß er durfte, und war überrascht. Ich war doch zuvor nie neidisch auf einen Kollegen gewesen.
»Hier fahren ja alle die gleichen Autos«, hat Boris in dem Interview festgestellt. Wo er recht hat, hat er recht. Irgendwie abfällig hat er sich nicht geäußert, und das fand ich sehr ehrenwert. Daß wir ziemlich viel Mist bauten, wußten wir inzwischen selbst. Ein paar Tage später kam die Wende. Ich ging nach München und arbeitete einiges auf, in erster Linie für mich. Aber als meine Kollegen klatschten, weil Wasmeier Olympiagold gewann, tippte ich Zahlen in den Computer. Dafür waren sie beschäftigt, als ich mich über Weißflog freute. Erzähle bloß keiner Schleim. Wir sind von weit entfernten Punkten aufeinander losmarschiert. Bei Boris treffen wir uns schon. Ich finde es genial, wie er sagte, er habe zuerst gar nicht wahrgenommen, welche Hautfarbe Barbara hat. Außerdem spielt er wohl wirklich nicht schlechter Tennis als Thomas Emmrich.
Читать дальше