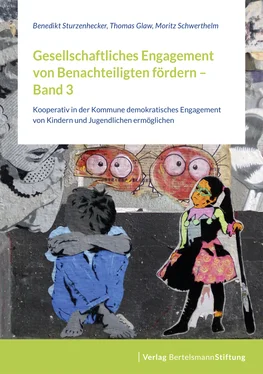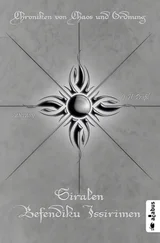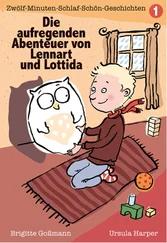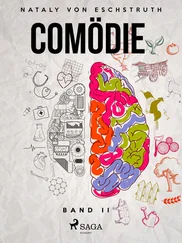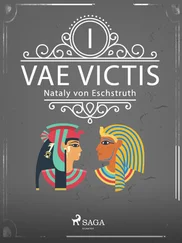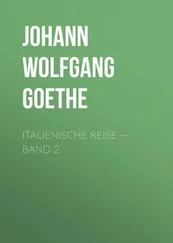Werner Lindner hat in den vergangenen Jahren besonders für die Kinder- und Jugendarbeit pointiert herausgearbeitet, dass und wie sie sich in die kommunale Jugendpolitik einmischen kann und muss. Für dieses Buch hat er dazu einen neuen Text erarbeitet, der den zweiten Teil eröffnet. Darin begründet und beschreibt der Autor, wie die kommunalpolitischen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe beschaffen sind.
Zu diesem Thema hat Werner Lindner zusammen mit Winfried Pletzer vor zwei Jahren ein wichtiges Buch herausgegeben (Kommunale Jugendarbeit, Weinheim 2017). Diesem Band haben wir zwei Texte entnommen, die bedeutende methodische Ergänzungen für politisches Handeln der Kinder- und Jugendhilfe in der Kommune enthalten. Marco Althaus referiert sehr greifbar die Grundsätze der Politikberatung für die kommunale Jugendlobby – was also Fachkräfte wissen und tun müssen, um lokale Politik zu jugendpolitischen Themen beraten und beeinflussen zu können. Herbert Schubert, ein ausgewiesener Experte für Netzwerkgestaltung, gibt Wissen und konkrete methodische Hinweise zur Identifizierung und Gestaltung von Netzwerken in der Kommune.
In den bisherigen Publikationen zur GEBe-Methode wurde ein wichtiges Thema der lebensweltnahen Partizipation von jungen Menschen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nur am Rande erwähnt: wie Differenz und Unterschiedlichkeit mit dem Anspruch auf gleichberechtigte demokratische Teilnahme verbunden werden können. Kinder und Jugendliche sind auf verschiedene Weise unterschiedlich und das hat Folgen dafür, wie sie sich in demokratische Mitentscheidung und Mithandlung einbringen können. Will man gleiche Beteiligung als Recht für alle sichern, muss man Differenz und Ungleichheit erkennen und bewusst damit umgehen.
Wie Differenz und Ungleichheit zusammenhängen und welche benachteiligende Wirkung sie auf unterschiedliche Menschen haben können, erläutern Melanie Plößer und Benedikt Sturzenhecker in ihrem Text zur Differenz und Demokratie im Partizipationsalltag der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird gezeigt, dass für den Gleichheitsanspruch von Demokratie die doch real bestehende Ungleichheit reflexiv erkannt und bewusst in der sozialpädagogischen Forderung nach Demokratiebildung berücksichtigt werden muss. Ganz konkrete Reflexionsfragen, die sich für die praktische Nutzung in Teamsitzungen anbieten, prägen diesen Artikel. Benedikt Sturzenhecker geht anschließend noch einen Schritt weiter und schlägt methodische Arbeitsweisen vor, wie in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe konkret eine differenzbewusste Demokratiebildung gefördert werden kann.
In den letzten drei Beiträgen des Buches geht es um Vertiefungen und Erfahrungen mit der Methode. Zwei Fachkräfte, die am Berliner KoKoDe-Modellprojekt des Nachbarschaftsheims Schöneberg teilgenommen haben, Jenka Doris Bühler und Anja Henatsch, entwickeln Verbindungen zwischen der von ihnen angewandten Methode der gewaltfreien Kommunikation und der GEBe-Methode – ganz konkret ausgerichtet an ihren Erfahrungen mit beiden Arbeitsweisen in der Jugendkulturarbeit.
Alicia Picker nutzt die Modelle der Theorien zu erfahrungsbasiertem Lernen aus der Psychologie, um Lernprozesse von Fachkräften im Umgang mit der Methode zu beleuchten. Deutlich werden dabei Krisen und Potenziale solcher Lernprozesse im Umgang mit GEBe.
Schließlich berichtet Annalena Uhlenbrock aus einem Forschungspraktikum, in dem sie zwei Jugendpfleger des Kreises Gütersloh zu deren Erfahrungen mit der GEBe-Methode befragt hat. Sie zeigt, wie ein Kreisjugendamt die Fachkräfte der offenen Jugendeinrichtungen bei der Realisierung der Methode beraten sowie methodisch bewusstes Handeln und fachliche Reflexion nachhaltig stärken kann.
A | „Kooperativ in der Kommune: Demokratisches Engagement von Kindern und Jugendlichen fördern (KoKoDe)“ – Methodisches Konzept, Modellprojekt, Evaluation für Träger und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
Wie Kinder- und Jugendhilfe kooperativ in der Kommune demokratisches Engagement von Kindern und Jugendlichen fördern kann
Benedikt Sturzenhecker
In diesem Beitrag wird die Weiterentwicklung der Methoden zur Förderung gesellschaftlich-demokratischen Engagements von (benachteiligten) Kindern und Jugendlichen (GEBe-Methode) in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit entworfen und begründet. Dabei geht es darum, wie man nicht nur in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe demokratische Partizipation ermöglichen kann, sondern auch davon ausgehend Kinder und Jugendliche unterstützt werden können, ihre Themen und Anliegen öffentlich in der Kommune zu präsentieren, sie mit anderen zu debattieren und sich schließlich an demokratischen Entscheidungen und deren Umsetzung zu beteiligen. Dies sollte nicht nur bezogen auf einzelne Einrichtungen geschehen – indem etwa eine Kita oder ein Jugendzentrum ausschließlich mit ihren beziehungsweise seinen Teilnehmer*innen in die politische Öffentlichkeit gehen würde –, sondern die unterschiedlichen (sozial-) pädagogischen Einrichtungen sollten dabei auf der lokalen Ebene kooperieren. Dieser konzeptionelle Ansatz wurde in dem Modellprojekt „ Kooperativ in der Kommune demokratisches Engagement von Kindern und Jugendlichen fördern“ (kurz KoKoDe) erprobt und weiterentwickelt. Das Projekt wurde von der Bertelsmann Stiftung im Rahmen des Projekts jungbewegt gefördert und vom Autor in Kooperation mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V., einem großen Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin, durchgeführt.
Mit den hier verwendeten Begriffen einer lokalen Ebene und/oder Kommune sind zunächst die Orte gemeint, an und in denen die Kinder und Jugendlichen leben. Dazu gehören nicht nur die pädagogischen Institutionen, die Wohnhäuser, die Familien und die öffentlichen Aufenthaltsorte, an denen Menschen sozial interagieren und arbeiten, sondern auch deren Zusammenhang als ein „Ort aus Orten“ (Richter 2018) wird hier als Kommune bezeichnet. Kommune wird dabei verstanden als Netzwerk räumlicher, sozialer, wirtschaftlicher und politischer Strukturen und Handlungspraxen, in dem die Kinder und Jugendlichen, ebenso wie die Erwachsenen, lokal Mitglieder sind als demokratische Bürger*innen. Damit wird angenommen, dass sich die lebensweltlichen Handlungsorte mit den Orten und Handlungsformen einer politischen Öffentlichkeit und demokratischen Kommune überschneiden. Dort, wo Menschen leben und arbeiten, ihr Leben produzieren und reproduzieren, Erziehung und Bildung gestalten, dort sind sie auch beteiligungsberechtigte Bürger*innen der demokratischen Kommune.
Prinzipiell gilt es in einer demokratisch orientierten Sozialpädagogik, den Kindern und Jugendlichen nicht nur demokratische Beteiligung an ihren pädagogischen Orten zu eröffnen, sondern ihnen auch zu ermöglichen, als Mitglieder in der politischen Öffentlichkeit der Kommune mitzuhandeln und mitzuentscheiden und so die kommunale Demokratie mitzugestalten. Das Netz aus Orten, in dem Kinder und Jugendliche lokal beziehungsweise kommunal leben, soll für sie bewusst und begreifbar werden, indem sie sich selbst darin als berechtigte Mitglieder und Mithandelnde erkennen und verwirklichen können. Idealerweise sollten sie nicht als partikulare Gruppe („Jugend“) und Objekte pädagogischer Fürsorge und Betreuung behandelt werden, sondern sollten immer in Bezug zu anderen Institutionen und Gruppierungen mit Blick auf das Gemeinwesen selbst handeln können.
Ein ausgezeichneter Ansatz dafür bestünde darin, dass die lokalen (sozial-) pädagogischen und bürgerschaftlichen Einrichtungen – Kinder- und Jugendhilfe, Schule, Vereine, Kirchen und so weiter – so kooperierten, dass sie ihre Adressat*innen unterstützen, sodass diese ihre Themen, Interessen und Konflikte selbst in die gemeinsame lokale Öffentlichkeit bringen und sich an Diskussion, Entscheidung und Umsetzung beteiligen könnten. Es geht also in dem hier vorgeschlagenen Konzept darum, wie eine solche demokratische Engagementförderung durch Zusammenarbeit (sozial-)pädagogischer Organisationen in der Kommune gestaltet werden könnte.
Читать дальше