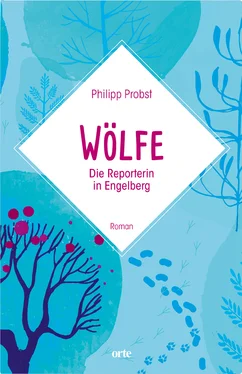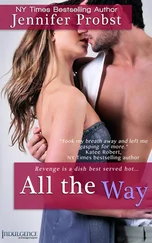Doch auch in der zweiten Nacht lag sie meistens wach. Oder sie sass dick eingepackt und mit Wollsocken an den Füssen vor der fast erloschenen Glut im Cheminée und versuchte, ein bisschen Wärme aufzunehmen. Trotzdem zitterte sie.
In der dritten Nacht konnte sie es nicht mehr schönreden, Marlène hatte eine furchtbare Angst. Sie zweifelte ernsthaft, ob ihre Idee gut war: sich eine Zeit lang in die Einsamkeit zurückzuziehen, zu sich selbst zu finden, Tagebuch zu schreiben, in der Natur zu sein und den ganzen Horror der letzten Monate zu verarbeiten.
Sie wollte nicht aufgeben. Aber sie änderte den Tagesablauf. In der vierten und fünften Nacht liess sie das Feuer und die Petroleumlampe brennen, sass am Tisch und schrieb. Erst gegen Morgen legte sie sich schlafen. Zumindest für drei, vier Stunden. Das klappte gut.
In der sechsten Nacht – sie war gerade in ihr Tagebuch vertieft – hörte sie plötzlich ein Kratzen, ein Scharren, ein Rumpeln. Sie wagte kaum zu atmen. Sie blies die Lampe aus. Die Glut in der Feuerstelle tauchte die Hütte in schwaches, rötliches Licht. Alles war wieder still. Sie erhob sich und packte ihre Taschenlampe. Sie öffnete die Türe und linste vorsichtig hinaus.
Sie leuchtete den Bergweg hinunter. Nichts. Sie fuhr mit dem Lichtkegel die Weide ab, auf der im Sommer die Kühe grasten. Nichts. Sie suchte den Wald ab. Nichts. Als sie die Taschenlampe auf die Wipfel der Bäume richtete, sah sie, dass diese weiss gepudert waren. Es hatte geschneit.
Sie schloss beruhigt die Türe, verriegelte sie und legte sich schlafen. Als sie gegen zehn Uhr aufwachte, sah sie, dass auch auf der Weide und am Boden ein Hauch Schnee lag. Sie zog sich an und ging nach draussen. Sie suchte nach Spuren. Wenn jemand in der Nacht da war, müsste er Fussabdrücke hinterlassen haben. Doch ausser Tierspuren fand sie nichts. Sie ging den Bergweg ein Stück hinunter bis zur Verzweigung. Es gab zwei Wege nach Engelberg: jenen über das Seitental Horbis, den sie gegangen war, und jenen direkt hinunter ins Engelbergertal. Beide waren etwa gleich lang. Sie schaute ganz genau auf die beiden Wege. Doch sie fand keine Spuren.
Marlène ging zum Haus zurück, öffnete den Fensterladen und nahm die Milch, den Käse und das Trockenfleisch in die Hütte hinein und gönnte sich ein ausgiebiges Frühstück. Plötzlich schien ein Sonnenstrahl in die Stube. Sie beendete ihre Mahlzeit, legte die Lebensmittel zurück auf den Fenstersims, verriegelte den Laden, zog ihre dicken Kleider an und machte einen Spaziergang. Die Wolken verzogen sich. Die Sonne wärmte und liess den Schnee schnell schmelzen.
Nun hatte sie freie Sicht auf Engelberg und ins Engelbergertal. Auch der 3238 Meter hohe Titlis strahlte hell. Der Gletscher war zugeschneit. Schnee lag auch auf dem Stand, der Zwischenstation der Titlisbahn. Von dort fährt die grosse Schwebebahn, die Titlis-Rotair, hinauf zum Klein Titlis, dem Nebengipfel des Titlis. Im Winter transportiert die Bahn die Skifahrer und im Sommer viele asiatische Touristen, die einmal in ihrem Leben Schnee anfassen wollen, in alpine Höhen.
Der Spaziergang tat ihr gut. Sie fühlte sich besser, leichter, selbstbewusster. Sie fühlte sich bestätigt: Ihr Plan war gut. Das Schreiben, die Einsamkeit, die Natur – all das stärkte sie, heilte ihre Seele. Sie war auf dem richtigen Weg.
Weil sie der ausgedehnte Spaziergang ermüdet hatte, ging sie an diesem Abend früher zu Bett und schlief sofort ein.
Sie erwachte, weil sie ein Knarren hörte, ein Kratzen. Eindeutig. Sie glaubte, es mache sich jemand an der Türe zu schaffen.
War er hier?
Sie bekam eine Höllenangst. Sie wagte kaum zu atmen. Aber es war still.
Doch plötzlich war es wieder da, dieses Geräusch! Rüttelte jemand am Fensterladen?
Wieder Ruhe.
Sollte sie sich verstecken? Wo? Im Kinderzimmer? Unter einem Bett? Nein, er würde sie finden! Was würde er mit ihr machen? Sie töten? Sie quälen?
Marlène schaute sich um. Gab es einen Gegenstand, den sie als Waffe einsetzen und ihm auf den Kopf schlagen könnte? Das Gewehr! Der alte Karabiner ihres Grossvaters! Wo aber war die verdammte Munition?
Sie hatte keine Zeit, danach zu suchen. Sie eilte ins Schlafzimmer, nahm das Gewehr von der Wand und ging zur Türe. Sie schloss sie auf, gab ihr einen Tritt und zielte mit dem Karabiner in die Nacht hinaus. Sie hörte ein Rascheln. Sie nahm die Taschenlampe, trat hinaus in die Nacht. Sie leuchtete den Weg hinunter. Nichts. Die Weide. Nichts. Sie liess den Lichtkegel langsam entlang des Waldrands streifen.
Dann sah sie es: Etwas reflektierte den Schein ihrer Taschenlampe. Ganz schwach. Augen? Reflektoren eines Kleidungsstücks? Sie schwenkte mit der Taschenlampe zurück. Sie zitterte.
Es war nichts mehr zu sehen.
Aber nun wusste sie: Sie war nicht allein.
Leas Coiffeursalon war voll mit elegant gekleideten Leuten. Die meisten Damen trugen Röcke oder stilvolle Hosenkleider, die Herren schwarze oder graue Anzüge. Nur einer fiel ein bisschen aus dem Rahmen: Jonas Haberer. Auch er trug zwar einen dunklen Anzug, dazu aber rote Cowboyboots und einen schwarzen Westernhut, verziert mit einem roten Seidenband. Er betrachtete ein Bild nach dem anderen. Lange und sehr genau. Wenn er sich bewegte, dann nur langsam und leise. Jonas Haberer trat nicht mit den Absätzen aufs Parkett und erzeugte für einmal kein lautes Klack–klack–klack, sondern er ging auf Zehenspitzen.
Lea, Elin und Marcel servierten Sekt, vegetarische Häppchen und gegrilltes Gemüse. Die Gäste standen in Grüppchen, diskutierten über die Bilder, nippten an ihren Gläsern und versuchten, die kleinen Sandwiches und Blätterteigtörtchen möglichst anständig und ohne zu kleckern in ihre Münder zu schieben.
Charlotte trug ein enges, kurzes, schwarzes Etuikleid, kniehohe Stiefel mit hohen Absätzen und sass auf einem Frisierstuhl. Sie beobachtete die Szenerie mit einem Lächeln.
Und dann war es so weit: Selma betrat den zur Galerie umfunktionierten Coiffeursalon. Charlotte stand auf, fasste ein Sektglas und schlug mit einem Löffel sachte dagegen. Laut sagte sie: «Eh, voilà, hier ist die Künstlerin. Meine Tochter Selma Legrand-Hedlund!»
Die Gäste drehten sich zu Selma um und applaudierten. Selma winkte kurz, fuhr sich mit der rechten Hand durch die Haare, lächelte, trat von einem Bein aufs andere und spielte an ihren Silberringen herum.
«Messieurs dames», sagte Charlotte. «Oder wie wir Schweden sagen: Hei!» Die Leute lachten kurz. «Es ist mir eine Ehre, Sie zu dieser Vernissage begrüssen zu dürfen. Es ist die allererste Vernissage dieser wundervollen Künstlerin. Und ich sage Ihnen, es war ein langer Weg bis zu dieser Ausstellung. Kunst soll und darf sich nicht verstecken, aber bringen Sie dies einer wahren Künstlerin bei!» Ein kurzes Raunen ging durch die Reihen. «Es brauchte nicht nur die liebevollen Worte von Selmas Schwester Elin, nicht nur viele Diskussionen und noch mehr Frisuren ihrer Freundin Lea und nicht nur die psychologische Beratung ihres Freundes Marcel. Nein, es brauchte ein – wie soll ich sagen – deutliches Wort ihres journalistischen Ziehvaters, der …»
«Es brauchte einen Tritt in den Arsch!», warf Jonas Haberer in breitestem Berner Dialekt ein. Die Leute lachten.
«Oder so», meinte Charlotte und lächelte angestrengt. «Und schliesslich brauchte es noch die Tatkraft ihrer Mama, die Sache zu organisieren und die Künstlerin vor ein fait accompli, vor vollendete Tatsachen, zu stellen.»
Die Leute lachten erneut und klatschten.
«Meine Damen und Herren», fuhr Charlotte fort. «Ich habe mich entschieden, nur einen kleinen Teil von Selma Legrand-Hedlunds Schaffen auszustellen. Es handelt sich um Bilder, die Selma während weniger Wochen im vergangenen Sommer gemalt hat. Die Künstlerin ist dabei zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Ihre früheren Bilder zeigten realistisch dargestellte Landschaften, später kamen abstrakte Landschaften hinzu, gefolgt von einer sehr düsteren, schwarzen Phase. Doch die Farben kehrten zurück. Der Grund dafür war ein prägendes Ereignis auf einer Alp im märchenhaften Saanenland. Und hier sehen Sie das Resultat: mystische, fantasievolle Bilder, die eine ungeheure Lebenskraft ausdrücken.»
Читать дальше