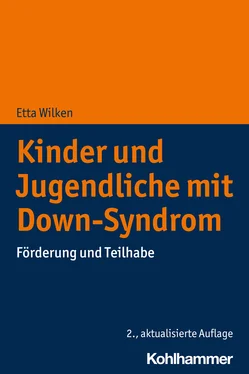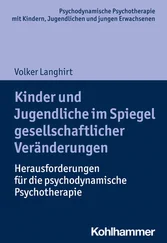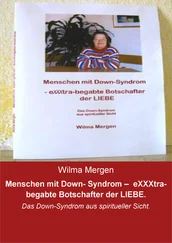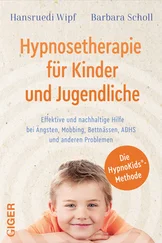Für die Sozialisation des Kindes sind sowohl die individuellen Bedingungen als auch die familiären Ressourcen bedeutsam.
Es ist deshalb wichtig, sich mit den aktuellen Entwicklungen der unterschiedlichen Lebensbedingungen von Familien und den teilweise konträren Erziehungshaltungen zwischen Verwöhnung und Vernachlässigung auseinanderzusetzen und daraus Konsequenzen zu ziehen für die Förderung der Kinder in familiären, aber auch in institutionellen Bereichen. Dazu gehört zu reflektieren, wie und was Kinder in ihrem normalen Lebensalltag lernen, wie sie durch Übernahme von Pflichten in der Familie und durch Spielen allein und mit anderen wesentliche natürliche Anregungen und Impulse erfahren.
Gerade dem so genannten inzidentellen Lernen, das sich nebenbei und eher zufällig in Alltagshandlungen und familientypischer Lebensgestaltung ergibt, kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. »Im Verlauf der ›beiläufigen‹ familialen Sozialisationsprozesse und gezielter Erziehungsbemühungen werden dem Einzelnen die für das (Über-)Leben in der jeweiligen Gesellschaft wesentliche Grundlagen vermittelt« (v. Kardorff, Ohlbrecht 2014, 15). Insofern ist es problematisch, wenn »im Bestreben ihren Kindern das Beste zu ermöglichen … die große Mehrheit der Eltern ihre Kinder vor allem von Alltagspflichten« entbindet (Konrad-Adenauer-Stiftung 2014, 4) und durch diese »Entpflichtung« das Lernen von Verantwortung und Leistungsbereitschaft ihrer Kinder gerade in verstehbaren Alltagszusammenhängen einschränkt. Auch bedeutet die Übernahme von Aufgaben und das Helfen-müssen nicht nur eine lästige Pflicht, sondern es eröffnet dem Kind in konkreten Situationen die wichtige Erfahrung von Helfen-können. Dadurch erlebt es unmittelbar die Bedeutung eigener Kompetenzen und das fördert sein Selbstbewusstsein und die Entwicklung von Selbstwertgefühlen.
Auch für das Aufwachsen von Kindern mit Behinderung ist es wichtig zu reflektieren, wie der gemeinsame Familienalltag zu gestalten ist und welche Möglichkeiten der normalen Teilhabe an Tagesabläufen und an Übernahme von Alltagpflichten und Einbindung in Routinen erfolgen kann. Damit kann ohne Therapeutisierung des Alltags natürliches inzidentellen Lernen gelingen. Gerade bei Kindern mit Down-Syndrom sind nicht nur die durch die Trisomie verursachten Schwächen zu betonen und zu behandeln, sondern auch die individuellen Stärken und famliengebundenen Möglichkeiten und Kontextfaktoren sind zu berücksichtigen. »Das durch die genetischen ›Baupläne‹ vorhandene individuelle Entwicklungspotential kann indes nur durch das Erfahren von förderlichen Umweltbedingungen (enriched environment) und in der Regel zuerst in der Eltern-Kind-Beziehung ausgeschöpft werden« (Peterander 2013, 2). Zwar sind auch die spezifischen Förderbedürfnisse des Kindes mit Down-Syndrom zu sichern, aber ohne das Kind oder das Familiensystem durch zu enge Vorgaben und rigide Förderpläne zu überlasten und die Chancen und Ressourcen des familiären Alltagslebens gering zu achten.
Die meisten Eltern haben – trotz zunehmend häufigeren Angeboten der pränatalen Diagnostik – vor der Geburt ihres Kindes nichts von seinem Down-Syndrom gewusst. Nur wenn besondere gesundheitliche Probleme oder spezifische Abweichungen aufgefallen sind oder wenn aufgrund des mütterlichen Alters entsprechende pränatale Diagnoseverfahren in Anspruch genommen wurden, sind manche Eltern schon vorgeburtlich informiert. Die Mitteilung über die Behinderung ihres Kindes ist – unabhängig vom Zeitpunkt der Diagnose – für alle Eltern eine traumatische Erfahrung. Bei einer pränatalen Diagnose kommt aber noch hinzu, dass ein Entscheidungsdruck entsteht, welche Konsequenzen die Eltern aus dieser Information ziehen wollen und wie die Beratung erfolgt.
»Mit 43 Jahren ist Claudia noch einmal schwanger. Es ist ein Wunschkind, das sich da ankündigt … In der 12. Schwangerschaftswoche weist Claudias Frauenarzt sie darauf hin, dass sie zur Nackenfaltenmessung zu einem Pränataldiagnostiker gehen kann. Sie lässt sich eine Überweisung ausstellen und vereinbart einen Termin … Claudia berichtet von einem mulmigen Gefühl während der Untersuchung. Ihre Befürchtungen bewahrheiten sich … Der Arzt erklärt ihr, dass die Nackenfalte auffällig verdickt sei, eventuell sei ein Herzfehler nicht auszuschließen, und er vermute, dass das Kind ein Down-Syndrom oder ›Schlimmeres‹ haben könnte … Sie vereinbaren einen Termin zur Fruchtwasseruntersuchung … und haben dann die Gewissheit, ihr Kind hat das Down-Syndrom … Sie entscheiden sich für ihr Kind.« (Hennemann 2014, 16)
Die Auseinandersetzung mit der Mitteilung, dass ihr erwartetes Kind das Down-Syndrom haben wird, kann den Eltern erschweren, einen positiven Bezug zum Kind zu behalten und die Schwangerschaft auszutragen. Oft sind die erlebten emotionalen Belastungen und auch die empfundenen sozialen Erwartungszwänge sehr schwer auszuhalten (vgl. Stockrahm 2015, 35). Zudem wird das Kind durch die Aufzählung der erkannten Abweichungen oft zu einem Mängelwesen. Die Unsicherheit über die möglichen Ausprägungen der Behinderung und eventuelle zusätzliche gesundheitliche Beeinträchtigungen können weitere erhebliche Ängste verursachen. Aus diesem Grund sollte man gerade diesen Eltern – wenn sie es wünschen – Kontakt zu anderen betroffenen Familien vermitteln und eine ethisch verantwortete Beratung und Begleitung anbieten. Auf der Grundlage einer eigenen positiven Einstellung zu Menschen mit Behinderung sind die Eltern bei ihrer individuellen Entscheidungsfindung zu unterstützen und ihnen ist ein realistisches Bild vom Leben mit einem Kind, das das Down-Syndrom hat, zu vermitteln.
Wichtig ist auch, subtilen Zuweisungen von Mitverantwortung für eine selbst gewählte besondere Familiensituation in der Öffentlichkeit entschieden entgegen zu treten. Solche Einstellungen erschweren nicht nur den Eltern, eine Entscheidung zu treffen oder ihre neue Lebenssituation zu bewältigen, sondern können auch zu einer Entsolidarisierung von Hilfe und Verantwortung für behinderte Menschen und ihren Familien führen.
Wenn keine sichtbaren Beeinträchtigungen oder deutliche spezifischen Veränderungen vorliegen, werden die meisten anderen Behinderungen erst erkannt, wenn das Kind schon einige Wochen alt ist oder noch erheblich später, wenn die Entwicklung abweichend erfolgt oder auffällig wird. Die Eltern hatten dann aber die Möglichkeit, eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, die noch nicht von einer Diagnose überschattet ist. Eltern von Kindern mit Down-Syndrom dagegen erfahren zumeist unmittelbar nach der Geburt oder wenige Tage danach die Diagnose, und damit wird ihnen oft die Freude über das neugeborene Kind genommen und Verzweiflung und Angst vor der ungewissen Zukunft überschatten den Beginn ihrer Elternschaft.
»Ich nahm ihn in meine Arme … und dann lag ich da, sah ihn an und dachte, die Welt geht unter! Ich konnte überhaupt nicht sprechen, ich habe sofort angefangen zu heulen. Immer nur der Gedanke, jetzt ist die Welt zu Ende, jetzt ist alles vorbei.« (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1998, 7)
Kinder mit Down-Syndrom werden relativ häufig einige Wochen früher geboren. Dann werden manchmal die typischen Merkmale nicht sicher erkannt oder man zögert eine klare Diagnosestellung hinaus, um den Eltern diese erste gemeinsame Zeit nicht noch zusätzlich zu erschweren.
»Unsere Zwillinge Luis und Ben kamen … zehn Wochen zu früh auf die Welt. Eine Zeit voller Hoffen und Bangen begann für uns … Wir freuten uns schon auf die Entlassung. Endlich würden wir eine Familie sein, endlich zu Hause, endlich Normalität … es sollte anders kommen: In der letzten Krankenhauswoche kam die Diagnose, dass Ben das Down-Syndrom hat, und die Nachricht brachte zunächst einmal unsere ganze Welt ins Wanken. Plötzlich war da die Angst, niemals wieder glücklich sein zu können! … Nach drei tränenreichen Tagen und Nächten stellten wir uns den Tatsachen und entschieden, einfach das Beste aus der Situation zu machen.« (Bodensteiner 2013, 69)
Читать дальше