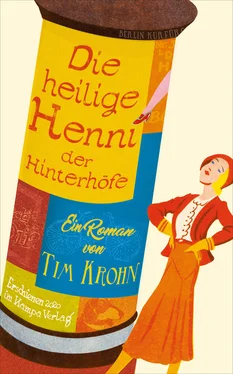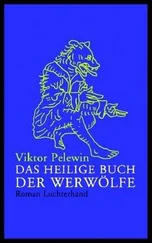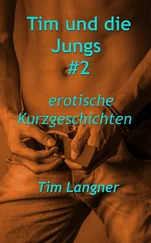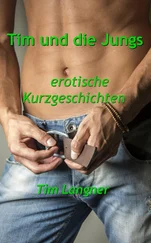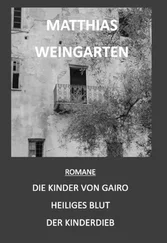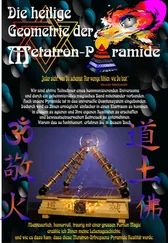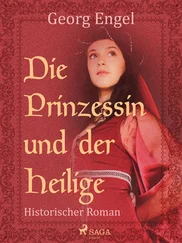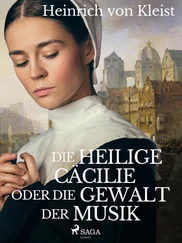Zu erfüllen hatte, damit was nicht geschah? Henni begriff überhaupt nichts. Was konnte denn passieren? Die deutschen Armeen hatten doch dauernd gesiegt! Und was war mit den Millionen Kriegsgefangenen und den abertausend Kilometern Landgewinn? Die konnte man doch tauschen! Oder war das alles nichts wert?
»Wir führen doch!«, rief sie verärgert, und an dem Abend heulte sie richtig dicke Tränen in ihr Kissen.
Als sie am anderen Tag noch mal zu Wertheim ging, weil dort der Krieg ja vielleicht doch weiterging, war das Schaufenster schon neu dekoriert. Wertheim verkaufte jetzt Schnittmuster, und an Puppen wurde vorgeführt, was sich aus Soldatenuniformen so alles »für Mutter und Kind« schneidern ließ.
Noch ein paar Wochen lang hing über der Eckbank am Küchentisch ein Blatt, auf das Kuddl in Schönschrift geschrieben hatte:
Die deutsche Kriegsbeute im vierten Kriegsjahr.
Berlin, 30. Juli 1918.
Die Leistungen des deutschen Heeres während des vierten Kriegsjahres kommen in folgenden Zahlen zum Ausdruck: Den Feinden wurden entrissen und von deutschen Truppen besetzt: im Osten 198’256 Quadratkilometer, in Italien 14’423 Quadratkilometer, an der Westfront 5’323 Quadratkilometer (geräumtes Gebiet an der Marne ist abgerechnet), im Ganzen 218’002 Quadratkilometer. Ferner halfen unsere Truppen vom Feinde bzw. von räuberischen Banden säubern: in Finnland 373’602 Quadratkilometer, in der Ukraine 452.033 Quadratkilometer, in der Krim 25’727 Quadratkilometer. An Beute wurden eingebracht: 7’000 Geschütze, 24’600 Maschinengewehre, 751’972 Gewehre, 2’867’500 Schuß Artilleriemunition, 102’250’900 Schuß Infanteriemunition, 2’000 Flugzeuge, 200 Fesselballons, 1’705 Feldküchen, 300 Tanks, 3’000 Lokomotiven, 28’000 Eisenbahnwagen, 65’000 Fahrzeuge. Die Zahl der im vierten Kriegsjahr gemachten Gefangenen beläuft sich auf 838’500, somit hat die Gesamtgefangenenzahl die Höhe von nahezu 3 ½ Millionen erreicht.
Doch da Klopapier inzwischen rar geworden war, nahm auch die stolze Heeresbilanz 18 bald den Weg alles Irdischen.
Nachdem der Krieg vorbei war, floss in Berlin erst richtig Blut. Nun ging es nicht mehr gegen die Franzosen, Engländer oder Russen, sondern gegen die Nachbarn. Zu Hause borgte man sich immer noch Wasser für die Toilette, aber auf der Straße war man einander spinnefeind. Justus Karnerich hielt es mit den Roten, Kalle Grafenhuber, der über ihm wohnte, mit den Freischärlern. Professor Hein regierte eine kurze Zeit als Sozialdemokrat mit (dann wollte seine Leber nicht mehr).
Auch in der Schule gab es welche, die trugen das Abzeichen vom Deutschnationalen Jugendverein oder vom Bismarckbund. Kuddl und seine Bande Gott sei Dank nicht, die wollten nur Spaß, und Kuddl konnte sich herrlich aufregen. Aber er hatte auch recht: Wenn Freikorpskämpfer, das waren die Rechten, sich als Truppen der Regierung verkleideten, die wiederum sozialdemokratisch war (»das Ganze is ja nun ne Republik«), und so am Montag die Kommunisten niederschossen und am Dienstag ein rivalisierendes Freikorps, am Mittwoch wiederum von der Regierung in Dienst genommen wurden, um hochoffiziell einen Streik aufzulösen, weil Polizei und Truppen das nicht »jebacken« kriegten, dann konnte man nur noch für die Kommunisten sein. Andererseits hieß es, die wollten, schlimmer noch als die Siegermächte, alle deutschen Werte zerstören und russische Verhältnisse einführen, und doch, kaum waren Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg glücklich erschossen und der Spartakusbund aufgelöst, ging halb Berlin auf die Straße und trauerte um die Leute, und die Regierung erschoss gleich noch mal tausend von ihnen. Das sollte jemand verstehen!
Dazu fiel, seit Frieden war, andauernd etwas aus, mal die Straßenbahn, mal der Strom, das Wasser oder die Post. Das bedeutete meist, dass irgendwo wieder eine Regierung gestürzt und die nächste an der Macht war, aber trotzdem ging alles gleich weiter.
Und weil ja nun kein Krieg mehr war und kein Endsieg mehr winkte, wurde es schwer, sich im Alltag zu amüsieren. Kuddls Bande gab dennoch ihr Bestes, und Henni trug weiter seine Klamotten auf, nannte sich Henri und war mit von der Partie.
Im Frühjahr 19 spitzte sich das »Tohuwabohu«, wie Frau Professor Hein es nannte, zu: Schulen wurden besetzt, Direktoren erschossen, auf den Pausenplätzen wurde gekämpft, und die Bande machte sich einen Sport daraus, durch Hinterhöfe und über Dächer in die abgesperrten Straßen zu kommen und im Rücken der Kampfverbände wieder raus.
Trotzdem war irgendwie Frieden, Frieden mit Aprilwetter sozusagen.
Zum Beispiel spazierten Binneweisens mit zehntausend anderen Unter den Linden entlang (am Sonntagmorgen ging sogar Mama an die frische Luft), als plötzlich Panzer auffuhren, alles rannte und sich versteckte, ein bisschen geschossen wurde, mal von vorn, mal von hinten. Doch schon nach ein paar Minuten war alles vorbei, die Leute kamen wieder aus den Torbögen hervor. Wer sich hingeschmissen hatte, dem klopfte man den Staub ab, dann flanierten alle weiter.
»Wir lassen uns den Frieden nicht vermiesen«, sagte Mama bei der Gelegenheit und steckte seelenruhig das Hütchen neu, und Henni musste lachen, weil Mama so verdreht dachte, denn in Wahrheit hatte doch der Frieden den Krieg vermiest.
Das fand jedenfalls – mal abgesehen von den Eltern Binneweis – ganz Berlin, und damit es nicht zu langweilig wurde, war jetzt jeden Abend Vergnügen angesagt. Alle rannten dauernd zum Tanzen, und zwar zu amerikanischer Musik.
»Die enthemmt so herrlich«, sagte sogar Hennis Lehrerin Frau Kannegießer, die ging auch.
Und mit der Musik kamen Kleider, die das Knie frei ließen, Seidenstrümpfe waren der letzte Schrei, und bei so einem Seidenstrumpf will man ja immer auch wissen, wo er denn aufhört. So war für Aufregung gesorgt, und wenigstens nachts war das Endziel wieder klar: Der Feind war erlegt, wenn er Stielaugen machte. Im Nu war Berlin »sexualisiert«, wie Kuddl es nannte, wobei er das Wort lutschte wie einen Bonbon.
Auch Henni wurde »sexualisiert«, allerdings nicht beim Tanzen. Sie waren als Bande unterwegs gewesen und hatten ein Sperrgebiet hinterm Alex »erobert«, dabei waren sie in ein Gefecht geraten und wurden versprengt. Henni rettete sich in einen Kohlenkeller, zusammen mit Herbert, einem Hageren mit Bürstenschnitt aus Kuddls Jahr, der immer schnell rote Flecken ins Gesicht bekam. Dort saßen sie erst mal fest, denn oben wurde immer wieder geschossen. Eine Weile lehnte jeder an seiner Wand und hörte nach draußen, dann sagte Herbert ganz aus dem Nichts: »Glotz mich nich so an.«
Henni erschrak, weil seine Stimme sonderbar kollerte, außerdem hatte sie gar nicht ihn angeglotzt, sondern ihren Fingernagel, den sie sich auf der Kohlerutsche eingerissen hatte. »Ich glotz dich doch gar nicht an«, sagte sie und sah hoch, »du bist der, der glotzt.«
»Siehste«, sagte Herbert und grinste, »jetzt glotzte mich doch an.« Dann räusperte er sich.
»Ich seh nur deine roten Flecken an«, antwortete Henni und lutschte Blut.
»Die hab ich wegen dir.«
»Blödsinn, die hast du vom Rennen. Du kriegst immer so rote Flecken.«
»Ja, aber von dir«, beharrte Herbert und wurde immer heiserer, da half alles Räuspern nichts.
Henni sagte dann nichts mehr, und wäre draußen nicht mehr geschossen worden, wären sie wohl aufgestanden und wieder raus.
Aber es wurde noch, und Herbert holte tief Luft, hustete und verriet: »Ich kriege von dir nicht bloß rote Flecken.«
Henni tat, als interessierte sie nur ihr Nagel, obwohl sie schon neugierig war, was jetzt kam.
»Willste nich wissen, was ich noch krieg?«
»Nee«, sagte Henni, »von mir kriegste jedenfalls nüscht.« Gleichzeitig hörte sie draußen wieder eine Salve und freute sich, denn sie wollte hier so schnell nicht wieder weg.
Читать дальше