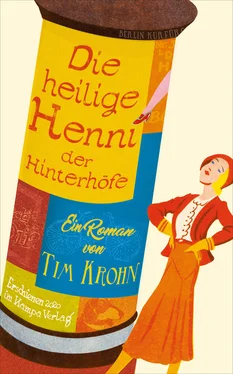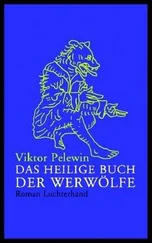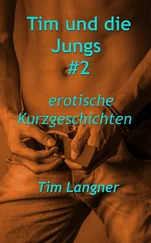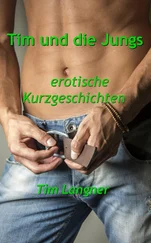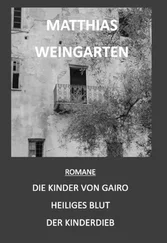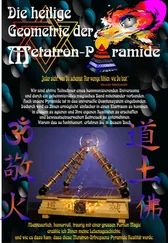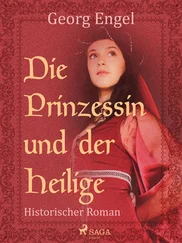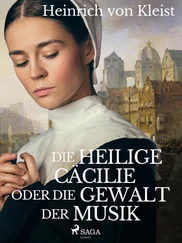»Henni, hältst du durch?«, fragte er davor. »Ich hole die Feuerwehr.«
»Ich will bei Josty dafür aber Wiener Schokolade mit viel, viel Sahne«, erklärte Henni.
Arthur Binneweis humpelte los, schrie und ächzte bei jedem Schritt und war bald schweißgebadet.
Danach ging alles ganz schnell: Zwei Mann rückten mit dem Leiterwagen aus, und bis Arthur Binneweis sich zurück zur Hasenheide gekämpft hatte, war der eine schon bei Henni, hob sie vom Gerüst, setzte ihr seinen Helm auf und trug sie runter.
Während Arthur Binneweis sich ans Pauschenpferd klammerte und nach Luft rang, machte Henni es sich auf dem Arm des Feuerwehrmanns gemütlich.
»Entschuldige dich bei den Herren für die Mühe, Henni«, sagte Arthur Binneweis.
Doch ehe Henni etwas sagen konnte, lachte der eine Feuerwehrmann. »I wo, Ihr Frollein Tochter is nu mal eene, die will hoch hinaus, find ick prima. Fußvolk ham wir ja mehr als jenuch in Preußen. Ihre Henni dagegen, dit sarick Ihn, is zu Höherem jeborn, aus der wird wat. Da wernse noch staunen.«
Und danach setzte er Henni sogar auf den Leiterwagen und kutschierte sie zur Straßenbahn, Arthur Binneweis humpelte hinterher. Zum Café Josty schaffte er es nicht mehr. Als sie nach Hause kamen, war sein Knöchel geschwollen wie eine Melone, Fieber hatte er auch, und statt heißer Schokolade gab es nun Essigwickel oben und unten.
Dafür hatte er eine Geschichte, die er von da weg an jedem Geburtstag erzählte. Henni sagte meist nicht viel, sie erinnerte sich auch bald nur noch daran, wie sie der Feuerwehrmann vom Gerüst gehoben und gesagt hatte: »Die Henni is zu Höherem jeborn.«
Und wenn in ihrer Mietskaserne am Prenzlberg wieder Katzenjammer herrschte, weil es mit Deutschland einfach nicht aufwärtsgehen wollte, und erst Krieg mit den Hottentotten war und dann oder darum oder trotzdem Hunger herrschte, in Moabit Kohlearbeiter und Kutscher erschossen wurden, weil sie nicht mehr hungern wollten, die deutsche Fußballelf gegen England nur unentschieden spielte und dann auch noch die Titanic unterging, die doch laut Papa nicht nur das größte Schiff der Welt gewesen war, sondern vor allem ein Beweis für den Sieg des modernen Menschen und darum als Sonderdruck des Berliner Anzeigers über der Essbank gehangen hatte, und Mama heulte: »Was soll in soner Welt nur aus den Kindern werden?«, dann wusste Henni immer genau, dass aus ihr schon etwas werden würde, wenn auch noch nicht abzusehen war, was.
Arthur Binneweis konnte sich für seine Tochter nichts Besseres denken, als dass sie Fräulein vom Amt oder Stenotypistin würde. Hennis Mama Ruth Binneweis versuchte sie dagegen für die Häuslichkeit zu begeistern: für fachgerechtes Scheuern der Fußböden (Fettlauge und Bürsten nach Strich für die Bohlen, Milchwasser und Leinen für den Linoleumteppich, dazu täglich Bohnern mit einem Ärmel von Papas alter Jägerjoppe, die ihm lange vor Hennis Geburt ein aufgebrachter Terrier zerrissen hatte, als er auf Pirsch mit seiner schlagenden Verbindung gewesen war, sowie Salmiak und kaltes Wasser für den gelackten Flur), fürs Wäschewaschen mit Kleie, Borax und Essig, und zwar mit Hebelwaschmaschine und Dampfwaschhafen, fürs Entfernen von Flecken in der Wäsche mit Sauerkleesalz und Schwefeldampf, Panamarinde, Terpentin, Magnesia, Löschpapier und Soda, fürs Stärken, Walken, Flicken, Bügeln, fürs Heizen, Kochen, Einmachen und Backen mit Klingenberger Turff, englischer Anthrazit- oder belgischer Würfelkohle, Buche, Kiefer oder Petrol, fürs Lampen-, Herd- und Öfenputzen, fürs Bettenmachen und Teppichklopfen, Sticken, Stricken, Nähen, Häkeln, Knüpfen, Flechten, für ordentlich Ordnung im Wäscheschrank, für Einkauf und Buchführung mit Einschreiben und Abschluss, Menüplanung und Lagerung.
Doch Henni begeisterte sich nur für die Wartung des Erste-Hilfe-Schränkchens, weil sich dabei manch wunderbar Schauriges denken ließ, und fürs Pumpen an der Waschmaschine. Dabei malte sie sich aus, sie fahre auf der Eisenbahn-Draisine noch weit hinter die Hasenheide, und zwar ins wilde Kurdistan, von dem Kuddl ihr erzählt hatte (er las, seit er die Daimon-Taschenlampe hatte, jede Nacht bis in die Puppen unter der Bettdecke Karl May) und wo sie sicherlich Größeres werden konnte als neben ihrer Mama. Die war eine stille, duldsame Frau, verrichtete, seit Henni denken konnte, Tag für Tag im selben schwarzen Wollkleid mit Krinoline und Haarteil die Hausarbeit, und fragte Michel Pavellek oder Frau Professor Hein nach ihrem werten Befinden, sagte sie immer nur: »Och, das Jesulein am Kreuze hat doller gelitten, denk ick ma.«
Das sagte sie auch, wenn Henni sich wieder mal das Knie aufschlug: »Nu, nu, nu«, sagte sie, »das Jesulein am Kreuze …« Und selbst, als Kuddl im Hof von der Leiter fiel, weil er um eine Murmel gewettet hatte, dass er es schaffte, auf einer freistehenden Leiter bis ganz nach oben zu steigen, und einen offenen Bruch am Arm davontrug, der Knochen kiekste aus dem Fleisch, und Kuddl brüllte wie am Spieß, da meinte sie nur: »Weißt du, Kurt, das Jesulein am Kreuze …«. Dabei machte der Anblick sie ganz käsig im Gesicht, und dann übergab sie sich.
Als das passierte, war Henni acht und heulte danach den ganzen Abend, und Arthur Binneweis saß noch lange bei ihr am Bett, versuchte sie zu trösten und rief: »Das Kind hat einfach zu viel Gemüt!« Dabei heulte Henni, weil sie gemein fand, dass Kuddl den Arm gebrochen hatte und nicht sie und dass er in die Charité gefahren worden war und jetzt einen großartigen Gips hatte, und zum Abendbrot hatte Mama Binneweis sein Lieblingsessen gekocht, ausgerechnet, Eisbein mit Kartoffelsalat, das sie sonst nie kochte, weil Henni Eisbein nicht ausstehen konnte, und ganz allgemein war Kuddls Unfall das Größte, was den Binneweisens je passiert war. Und dabei war doch sie diejenige, die hoch hinauswollte, und nicht Kuddl, das war einfach nicht gerecht.
Eine zweite Ahnung von Größe erlebte Henni im Jahr darauf, als Mamsell Szàbo, eine Ungarin, die eigentlich als Zugängerin in Pankow arbeitete, an Schwindsucht darniederlag. Mama Binneweis brachte ihr manchmal doppelte Kraftbrühe, und Henni ging gern mit, weil der Anblick, wie die Mamsell so wächsern und fast schon tot in ihrer schmutzigen Spitzenbettwäsche in der engen Besenkammer lag und röchelte, großartig feierlich war, und wenn sie was sagte, roch es nach Gruft, und einmal kam plötzlich ein Schwall Blut aus ihrem Mund. Aber auch Mamsell Szàbo kam dann zum Sterben in die Charité, und das ganz plötzlich. Als Henni von der Schule kam, war schon alles geschehen, und Justus Karnerich, das Faktotum in der Mietskaserne, räucherte gerade die Besenkammer aus. Die stand danach eine Weile leer, und manchmal versteckte Henni sich darin und spielte schwindsüchtig, denn darin steckte wenigstens eine Ahnung von Größe. Aber richtig wahre Größe war es noch nicht.
Die kam erst, als Kaiser Wilhelm den Serben den Krieg erklärte. Am nächsten Tag schon wurde mobilgemacht, und halb Berlin rannte zum Schloss, um ihm zuzujubeln, und der Kaiser hielt vom Balkon herab eine Rede. Binneweisens kamen zu spät, aber Justus Karnerich erzählte ihnen, dass der Kaiser von seiner verkrüppelten Linken einen Tennisschläger hatte baumeln lassen, ganz so, als wollte er die Serben damit persönlich verkloppen, das fand Henni wieder herrlich. Und alle sangen »Die Wacht am Rhein« und schrien: »Schlagt die Serben!« Als Binneweisens nach Hause kamen, begegneten sie der Professorengattin Hein, die mit ihrem Mann in der Beletage im Vorderhaus wohnte und der Henni öfters für einen Groschen den Dackel Gassi führte, und die fand: »Nun sollen unsere Männer dieses Pack mal tüchtig Mores lehren«, obwohl ihr Mann niemanden mehr Mores lehrte, denn der war bestimmt schon über sechzig und damit raus aus dem Alter, in dem man durch Schützengräben robbt.
Читать дальше