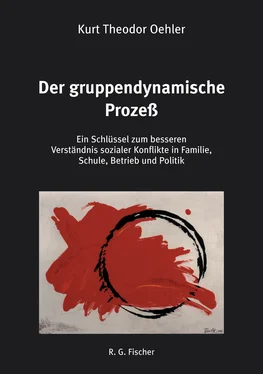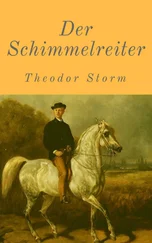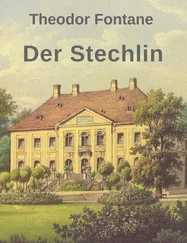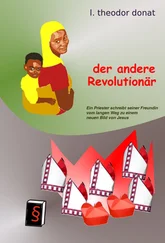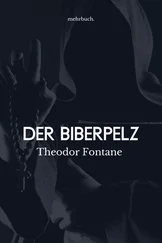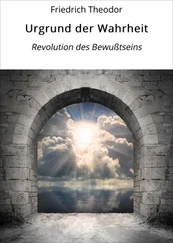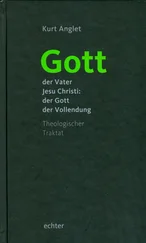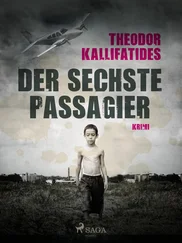Entsprechend seines Erlebnismusters erscheint die Lage des Schülers verzweifelt. Mit dem Rücken zur Wand versucht er sich zu wehren, indem er zum Angriff übergeht. Überleben scheint für ihn zu heißen: kämpfen, siegen oder untergehen.
Es ist offensichtlich, daß die Wahrnehmung des Schülers Scharfe verzerrt ist. Er nimmt beim Lehrer Wesensmerkmale wahr, die nicht oder nur in Ansätzen vorhanden sind. Selbst die Mitschüler erkennen die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des Schülers und dem tatsächlichen Verhalten des Lehrers. Aus der Klasse kommen Zwischenrufe wie: "Daß du nicht merkst, daß er dir nichts will!" Doch die Rückmeldungen aus der Schulklasse überzeugen Scharfe nicht.
Wie kommt es zu dieser Differenz zwischen der Wahrnehmung des Schülers und der Wirklichkeit des Lehrers? Und warum kann der Lehrer nicht adäquat reagieren? Welche Bedeutung hat diese Auseinandersetzung im Rahmen der Gruppendynamik der Schulklasse?
Es wird deutlich, daß der Schüler Scharfe seinen Lehrer mit einer anderen Person verwechselt. Er überträgt unbewußt Charaktermerkmale eines anderen Menschen auf den Lehrer. Sigmund Freud nannte eine solche Verwechslung "Übertragung". Obwohl die Mitschüler diese Übertragung deutlich spüren, ist es unmöglich, diesen Mechanismus dem Schüler Scharfe bewußt zu machen.
Der Lehrer hat als Junglehrer wenig Erfahrung im Umgang mit "schwierigen Schülern". Er kann die Bedeutung des Übertragungsgeschehens weder verstehen noch entsprechend damit umgehen. Er verfängt sich in widersprüchlichen Verhaltensweisen, versucht, sich beim Schüler kumpelhaft anzubiedern, und stellt sich unbewußt gegen die eigene Lehrerschaft. Er will nicht Lehrer der "alten Schule" sein.
Schwierige Schüler gibt es in allen Schulklassen. Diesen fällt in der Regel unbewußt die Rolle zu, den Lehrer in seiner Persönlichkeit herauszufordern. Diese Herausforderung gehört zum gruppendynamischen Prozeß.
Der Schüler Scharfe ist streitsüchtig, unbelehrbar und gleichzeitig intelligent. Er versucht, mit Hilfe des "formellen Normenkatalogs", der "Allgemeinen Schulordnung", seine eigenen Normen bzw. Wertvorstellungen gegenüber den Verhaltenserwartungen des Lehrers durchzusetzen. Es liegt aber am Lehrer, zu diesem Schüler einen persönlichen Weg zu finden und die Situation in der Klasse zu beruhigen. Der Lehrer muß sich mit seinen Normen durchsetzen, indem er als Vermittler des Lehrstoffes überzeugt und indem es ihm mit seinen charakterlichen bzw. persönlichen Fähigkeiten gelingt, die Interessen der Schule und der Schüler zu vertreten. Hier ist es aber der Schüler Scharfe, der, umgekehrt, dem Lehrer das Verhalten aufzwingt.
Doch folgen wir erst noch dem Bericht des Lehrers:
"In der Folgezeit versuchte Scharfe, durch sein Verhalten während des Unterrichts die Klassenkameraden davon zu überzeugen, daß ich eigentlich nicht derjenige sei, für den sie mich hielten. Er versuchte aufzuzeigen, daß ich hinterhältig sei und nur ab und zu so täte, als ob ich nicht zu dem 'Laden' gehöre, womit er die Institution Schule mitsamt der ihr gesetzlich zugeteilten Autorität meinte.
Von jetzt ab verliefen die Englischstunden in dieser Klasse in gespannter Atmosphäre und waren für mich persönlich nicht mehr so erfrischend wie in der Parallelklasse, in der derselbe Unterricht zügig und erfolgreich voranschritt.
Diese Spannung steigerte sich, als nach einem halben Jahr zwei weitere Schüler, nennen wir sie Kühne und Müller, zu dieser Klasse stießen. Es waren Schüler, die die Abschlußprüfung der BAS nicht geschafft hatten und das letzte der eineinhalb Jahre wiederholen wollten. Kühne war ein persönlicher Freund von Hans Scharfe.
Jetzt kam es noch häufiger vor, daß ein Teil der Unterrichtszeit mit Grundsatzdiskussionen verbracht wurde, die ich im wesentlichen mit Scharfe, unterstützt von seinem Freund Kühne, führte. Thema waren in den meisten Fällen die für die gesamte Klasse unangenehmen Kurzarbeiten. Es wurden Gesetzestexte zitiert. Es wurde in Frage gestellt, ob es sinnvoll sei, bestimmtes Vokabelwissen zu überprüfen. Es wurde angeführt, daß die Benotung dieser Kurzarbeiten für einige Schüler deprimierend sei, da sie immer wieder nachgewiesen bekämen, daß ihre Leistungen nicht ausreichten. Es wurde behauptet, daß ich neue psychologische Methoden ausprobieren wolle, die Unsinn seien, und vieles andere mehr. Bei diesen Diskussionen zwang mich Scharfe durch immer extremere Forderungen und Behauptungen, gegen ihn Stellung zu beziehen. Ich versuchte meinerseits, der Klasse deutlich zu machen, daß Scharfes Argumentation für sie sehr gefährlich sei. Er lieferte nämlich in seinen Diskussionen all denen genügend Material zur Rationalisierung, die in meinem Unterrichtsfach schlechte Leistungen erbrachten. Nicht ihre Leistungen waren schlecht, laut Scharfe, sondern meine unzumutbaren Forderungen an die Schüler. Diese seien schuld an ihren schlechten Noten. Die schwachen Schüler, die das Problem hauptsächlich betraf, waren größtenteils nicht in der Lage, sich an dieser Diskussion adäquat zu beteiligen. Und die guten Schüler schienen mir in erster Linie nicht daran interessiert zu sein, eine solche Diskussion zu führen.
Nur in einem Fall hatte Scharfe offensichtlich Erfolg: Der nach meiner Meinung recht intelligente Schüler Franz Keller schwenkte auf die Seite von Hans Scharfe ein. Das tat mir besonders leid, da ich mich mit Keller im ersten Halbjahr sehr gut verstanden hatte. Keller, so kann man verallgemeinernd sagen, hatte wegen zunehmender Probleme in Mathematik für das Fach Englisch nichts mehr gearbeitet, was natürlich dazu führte, daß seine Leistungen im Laufe der Zeit immer schlechter wurden. Als er zur Zeit der Zwischenzeugnisse zwischen 'befriedigend' und 'ausreichend' stand, gab ich ihm die Note 'ausreichend', um ihm zu signalisieren, daß es ohne Einsatz nicht mehr gehe. Das war, wie ich später erfuhr, der Anlaß für Keller, auf Scharfes Argumentation zu hören und ihm zu folgen.
Damit bildete sich nach und nach in der Klasse eine Gruppe von vier Schülern (Scharfe, Keller, Kühne und Müller), die entschlossen versuchten, den Unterricht zu zersetzen. Auch die Sitzordnung spiegelte die Situation wider. Die vier saßen am Fenster in der hinteren rechten Ecke des Schulzimmers."
Der weitere Verlauf der Fallstudie zeitigt für den Lehrer eine verheerende Entwicklung. Tatsächlich gelingt es Scharfe, weitere Mitschüler um sich zu scharen und eine gegen den Lehrer eingestellte Kerngruppe zu bilden. Gegen diesen Block kann sich der Lehrer nicht mehr durchsetzen. Zwar ist er Träger einer Amtsmacht, die ihm aufgrund von Gesetzen, Regeln, Qualifizierung und Ausführungsbestimmungen zuwächst. Macht ist aber keine Eigenschaft von Systemen oder Strukturen (KÖNIG, 1996). Sie bleibt immer an ein Netz sozialer Beziehungen gebunden und muß sich in diesem Netz manifestieren. Nachdem der Lehrer anfangs noch versuchte, durch Argumente zu überzeugen, mußte er schließlich kapitulieren. Der Lehrer hat den Kampf verloren. Scharfe hat sich zum "gruppendynamischen Leiter" aufgeschwungen und bestimmt, ob der Unterricht geordnet verläuft oder nicht. Von seinem Widerstand bzw. von seiner Zustimmung hängt es jetzt ab, welche Unterrichtsmethoden der Lehrer erfolgreich einsetzen kann.
Da der Schüler im Rahmen der formalen Schulorganisation immer der Schwächere ist, muß Scharfe nun versuchen, seine Macht von Zeit zu Zeit zu testen und zu demonstrieren. Mit Hilfe seiner Kenntnisse über das Schulgesetz fordert er den Lehrer immer neu heraus. Dieses Ränkespiel kann auf Dauer nicht gutgehen, denn schließlich ist es der Lehrer, der die Noten verteilt, die Zeugnisse schreibt und über den weiteren Werdegang mitentscheidet.
Aus diesen Gründen pflegen, wie die Fallstudie weiter zeigen wird, solche Konflikte zu eskalieren:
"Der Unterricht in dieser Klasse wurde immer unerfreulicher. Ich registrierte, daß ich mich massiv bedroht fühlte, wenn ich diese Klasse betrat, daß ich unsicher war, wenn ich Anweisungen gab, speziell an einen der vier Schüler. Als ich darüber hinaus feststellen mußte, daß ich mit meinem Unterrichtsstoff in dieser Klasse immer schlechter vorankam als in der Parallelklasse, brach ich eines Tages eine Diskussion mit Scharfe ab und erklärte, daß ich nicht mehr bereit sei, mich in der Klasse mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn er etwas mit mir diskutieren wolle, soll er in der Pause zu mir kommen.
Читать дальше