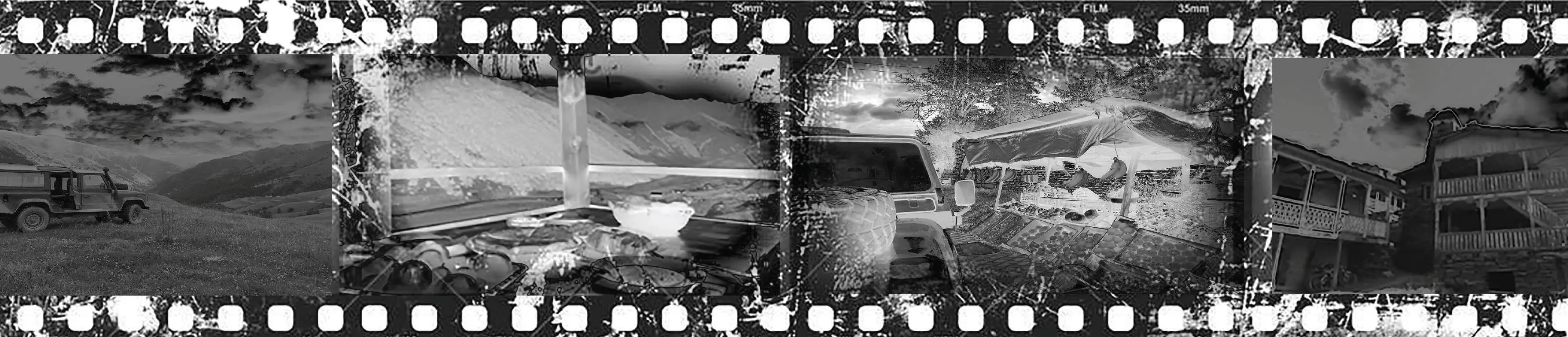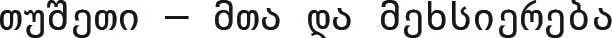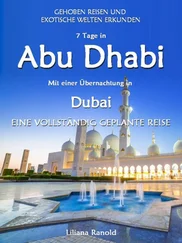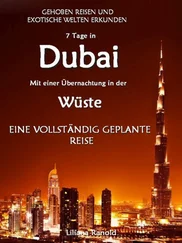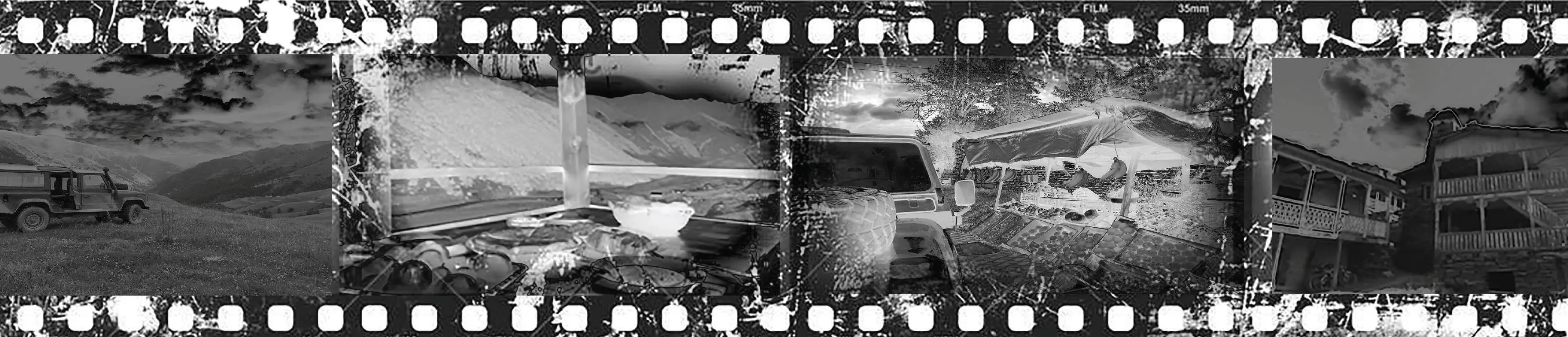
Wir erreichen Alisgori, unsere nächste Unterkunft, am Abend.
Die Solarzellen liegen hier auf den Dächern aus Schiefer, als hätten Außerirdische ihren Müll abgeworfen. Eine dünne Matratze auf einem Holzbrett, die Dusche wird mit Feuer geheizt, das Waschbecken steht im Freien.
4000 Kilometer von Berlin entfernt, mit geliehenen Wanderschuhen und einem Rucksack vom Discounter. Schmerz in den Muskeln, in den Füßen, Dreck unter den Nägeln, Staub im Haar, der Rücken von Bremsen zerstochen, Schafsfleisch zwischen den Zähnen. Ich stehe hier, schaue auf einen reißenden Gebirgsbach, und jeder Gedanke verschwindet.
Die Männer erzählen Heldengeschichten und trinken auf die Toten, auf die großen Krieger und die, die niemanden hinterlassen haben. Je tiefer die Nacht, desto länger werden die Trinksprüche. Bei jedem Glas preisen wir die Liebe, die Neugier, die Kunst, die Freundschaft, die Begegnungen, die unser Leben verändern, die Menschen, die Einfluss auf uns haben, die Leidenschaft, die Erinnerung, wir trinken darauf, dass wir diese Tage niemals vergessen werden. Wir trinken verdammt noch mal auf alles. Und dass diesen Männern das Preisen nicht ausgeht, lässt mir das Leben mit jeder Stunde reicher erscheinen. In solchen Nächten säuft man sich in die Demut.
Wir schlafen aus, nur einen einzigen Plan gib es heute: Hoch zu den Schäfern. Am Nachmittag um vier werden die Schafe gemolken, danach wird der Käse gemacht, und als ich den Weg sehe, der uns bevorsteht, spüre ich nichts als den drängenden Wunsch, schon dort zu sein.
Ich schleppe mich durchs Geröll, es geht steil hinab und dann sehr langsam wieder bergauf. A. reicht mir seine Hand, damit ich über den Bach springen kann. Ich hasse Wandern, ich hasse es wirklich. Am schlimmsten ist es, einen Weg zu gehen, den man hinterher auch wieder zurückmuss, wenn man weiß, was einen erwartet. Wir schleppen uns schweigend hoch, die Luft wird dünner.
Oben angekommen schlendert uns einer entgegen, der aussieht wie der Golem. Alles an ihm ist groß und bucklig. Das kommt vom Melken, sagt A. Seit Jahrzehnten melkt dieser Mann. G. zieht eine Flasche Schnaps aus seiner Jacke, wir betreten einen Verschlag, dessen Dach eine blaue Plastikplane ist. Uns alle verlässt die Farbe im Gesicht, wir sehen aus wie in einem nicht näher definierten Endstadium. Immer mehr Männer kommen herein. Nicht einer gibt mir die Hand, niemand sieht mich an. Höflichkeit sei das, Schüchternheit auch, versichert mir A. Ich tauche hier schließlich in Begleitung von zwei Männern auf, unantastbarer könnte ich kaum sein.
Der Tisch ist so niedrig, dass wir mit aufgestützten Armen dransitzen. Es gibt Hüttenkäse aus einer Blechschale, dazu Brot und Tomaten, Gurke und Melone. In der Ecke steht ein Gaskocher mit dem Namen »Harlem«.
Über uns baumeln weiße Säcke mit Getreide. Der Tschatscha wird geöffnet, wir trinken ihn aus dicken Patronenhülsen, doch in den Händen dieser Männer sieht alles winzig aus. Noch nie habe ich solche Pranken gesehen, noch nie habe ich solche Männer gesehen, nur Muskeln und kaum noch Zähne. Meine Unantastbarkeit weicht langsam auf, wir stoßen an auf die Freundschaft zwischen Deutschland und Tuschetien, die wir hiermit ins Leben rufen. A. haut mir auf die Schulter und lacht. Wild Woman, sagt er, und auch mir fällt es jetzt auf, wie ich hier hocke, kurz vor der tschetschenischen Grenze, zwischen einer Horde georgischer Schäfer, den Käse mit den Händen in den Mund stopfe, selbst gebrannten Schnaps aus einer Patronenhülse stürze und eine filterlose Kippe zwischen den Fingern halte.

Die Männer reden über Pferde, Hunde und Wölfe, bis der jüngste Schäfer Tuschetiens das Zelt betritt. Neunzehn Jahre ist er alt, und bevor er seinen Schnaps trinkt, rezitiert er minutenlang ein Gedicht. Kein besonders gutes Gedicht, wie A. mir zuflüstert, eines über Helden, Kriege und Siege, das Übliche eben. Wir trinken alle noch eine Hülse, bevor um Punkt vier Uhr die Schafe gemolken werden. Dreihundertsechzig Schafe. Pro Schaf ein halbes Teeglas Milch. Mir war zuvor nicht klar gewesen, was für ein Höllenjob das ist. Während die Melker in einer irren Geschwindigkeit melken, schwinden mir beim Zusehen langsam, aber sicher die letzten Kräfte. Ob er etwas für mich tun kann, fragt G., ob ich Wünsche hätte. An dieser Stelle sei gesagt, dass es kaum Besseres gibt, als mit zwei Männern durch die Wildnis zu reisen. Einer kümmert sich immer. Meine eigenen Wünsche sind mir oft nicht klar erkenntlich, doch in diesem Moment weiß ich genau, was ich will: Gebt mir ein Pferd, sage ich. Und G. geht los und klärt das. Eine halbe Stunde später wird ein Pferd gesattelt, und bevor ich aufsitze, gibt mir A. den besten Ratschlag, den ich je hörte, den ich mir als Lebensmotto an die Wand schreiben möchte:
Don’t smoke on the horse! Wir traben los, A. und G. stechen ihre Holzstöcke in die Wiese und folgen mir zu Fuß. Am Abend tut mir tatsächlich der Hintern weh, jetzt also auch noch der Hintern.
Ich schweige darüber.
Als wir am Tag darauf Omalo erreichen, ist das ein Schock. Wir sind zurück in der Zivilisation. Fast sechzig Häuser und alles ist Baustelle. Hier wird ganz groß aufgefahren, hier entsteht das Epizentrum des Tourismus. Es gibt eine Bäckerei, eine Bar, es gibt Strom, Musik, Bier, es gibt Mädchen, die sich kreischend aus Autofenstern lehnen, und Männer mit dicken Bäuchen. Ein paar Kühe liegen auf der Straße wie eine Reminiszenz an alte Zeiten. Die Wirtin hofft, im nächsten Jahr sogar Internet zu haben. Dann ist endgültig alles verloren, seufzt G., und ich nicke. Wir machen einen letzten Spaziergang zu den Wehrtürmen hinauf, ein letzter Gang, eine letzte fulminante Aussicht.
Am Morgen folgt der Rückweg in die Welt. Wir setzen uns auf den Abano-Pass, kurven zur Spitze hinauf, steigen aus für einen Blick zum Abschied.
Sechs Tage sind es nur gewesen, doch ich habe das Gefühl, Wochen hier verbracht zu haben, in dieser Ferne, die mich weiter wegbrachte von meinem Leben als jede Reise zuvor.
Wir fahren hinab, und dann geht es Schlag auf Schlag. Plötzlich piepen unsere Handys im Wagen, die Nachrichten von einer Woche treffen bei uns ein. Als Nächstes stellt G. den Allradantrieb aus, und ich muss mich wieder anschnallen. Wir fahren jetzt über Straßenbelag, die erste Ampel taucht auf, am Straßenrand Geschäfte und Autos.
Stunden später stehe ich mit A. in einem riesigen Hinterhof in Tbilissi, eine Bar neben der anderen. Fabrika heißt dieser Ort, so heißen sie überall auf der Welt. Wir stehen am Rand und wissen nicht, wohin mit uns. Es sind viel zu viele Menschen. A. sieht mich an und sagt: Stell dir einfach vor, es wären Schafe.

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Im Frühjahr 2018 erschien ihr vierter Roman »Töchter« im Rowohlt Verlag. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.

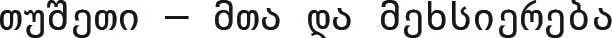
TUSCHETIEN – BERG UND GEDÄCHTNIS
Читать дальше