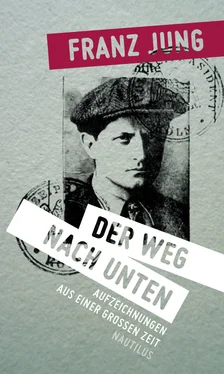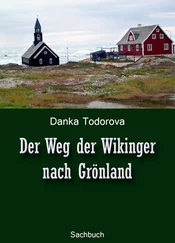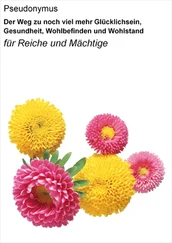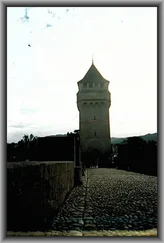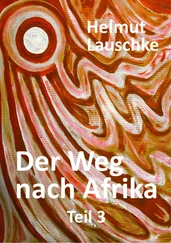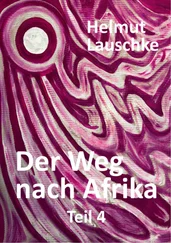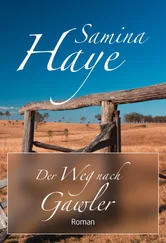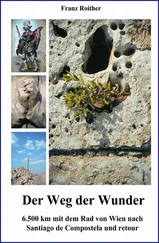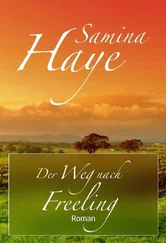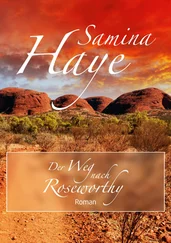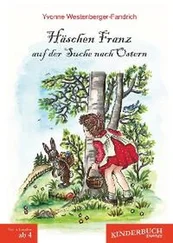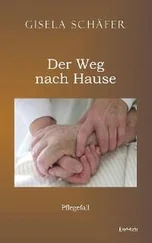Wenn ich hier bereits wieder etwas vorgreifen darf: Später, als Breuer in den ersten Revolutionsjahren Pressechef der Reichsregierung geworden war, habe ich ihn einmal nachts zufällig auf der Straße getroffen. Verschiedentlich war ich in Vorgänge verwickelt, die der Verfolgung durch das Presseamt unterstanden, zum Beispiel, als wir an die Auslandskorrespondenten in Berlin eine besondere Korrespondenz „Berlin Expreß“ täglich durch Boten austragen ließen, in der wir über versteckte Waffenlager und die Wiederbewaffnung Deutschlands berichteten – Breuer hat mir darüber keine Vorwürfe gemacht. Er war traurig und sprach sehr besorgt und sagte mir dabei, dass er schon einige dringende Anfragen erhalten habe, warum das Amt mich noch nicht den Gerichtsbehörden übergeben habe; man werde sonst zur Selbsthilfe greifen müssen. Bisher habe er solche Fälle immer noch abbiegen können, aber wie lange noch? – die Warnung kam sehr zur Zeit. Wir schieden damals mit einem festen Händedruck. Ich bin ihm viel schuldig geblieben.
Bis man sich über meinen Status entschieden haben würde, blieb ich in der Revierstube. Der Oberleutnant, dem der Rekonvaleszenten-Haufen unterstellt war, weigerte sich, mich zu sehen, genauer: Er bekam einen Wutanfall, wenn nur mein Name genannt wurde. Der Sanitätsfeldwebel dagegen hatte seine eigenen Pläne mit mir. Die zur ebenen Erde gelegene Revierstube eignete sich sehr gut dazu, das bei der Kompanie übrig bleibende Kommissbrot zu verkaufen. Zu einer bestimmten Stunde versammelten sich vor meinem Fenster die Interessenten, es wurde bald eine lange Kette von Käufern, die anstanden, – ich reichte die Brote heraus, kassierte das Geld, fünfzig Pfennig das Stück – der diensthabende Sanitäter stand schon hinter mir, das Geld sogleich in Empfang zu nehmen. Wahrscheinlich wird der Verkauf mit der Zeit aufgefallen sein. Eines Tages sagte mir der Sergeant vom Dienst, ich hätte sofort zu verschwinden. Er drückte mir eine Mark in die Hand mit dem Befehl, den Bahnhof Spandau zu meiden, mit der Straßenbahn zu fahren und am Spandauer Block umzusteigen. Auf diese Weise würde ich nicht in die Hände einer Militärkontrolle geraten. So wurde ich entlassen – wie schon früher gesagt, sang- und klanglos und ohne das geringste Papier.
Ich darf hier nicht vergessen zu erwähnen, dass manchmal, wenn die Kompanie ausgerückt war, die Knochen zu bewegen, mich die Revier-Sergeanten auf den Hof hinausgehen ließen. Die eine Seite des Hofes war durch einen kleinen Damm abgeschlossen, der mit Gras bewachsen war. Das Grün war mit Sommerblumen gesprenkelt, weiße Margeriten und blaue Glockenblumen. Darüber wuchsen zwei große Akazienbäume empor. Ich hatte mich an dem Abhang niedergelegt und dem Summen der Bienen gelauscht. Falter strichen über die Blumen hin. Und alle Süße der Welt lag in dem Duft der Akazienblüten. Ich habe diesen Duft in Erinnerung behalten, mehr als ich zugestehen mag. So stark, dass, wenn ich heute an einer Akazie vorübergehe, ich zögere, ich habe fast Mühe weiterzugehen – es ist nicht so leicht, eine solche Erinnerung einfach beiseite zu schieben.
Durch Vermittlung des Schutzverbandes erhielt ich eine Stellung als Handelsredakteur am Deutschen Kurier, einer neu gegründeten Berliner Tageszeitung, die von politischen Dissidenten-Gruppen aus Reichstag und Abgeordnetenhaus kontrolliert wurde, ausschließlich zu dem Zweck, die Industriefonds zur Bekämpfung der Steuergesetze zur Verteilung an die politischen Parteien an sich zu ziehen. Trotzdem geriet das Blatt sehr bald in Schwierigkeiten, die Gehälter konnten nicht gezahlt werden, und das Ende war abzusehen.
Mit einem Kollegen am Blatt gründeten wir den „Industrie-Kurier“, Fachblatt für die oberschlesische Eisen- und Kohlenindustrie unter der etwas anzüglichen Firma „Jung & Ehrlich“. Trotzdem wurde das Blatt ein voller Erfolg, wir erhielten Kredit, Ehrlich besorgte die Inserate, ich leitete die Redaktion.
Der Krieg fand unterdessen am Rande statt. Ich habe während dieser Jahre in diesem Geschäftskreis niemanden getroffen, der sich ernstlich für den Krieg und insbesondere für den Ausgang des Krieges interessiert hätte. Zwanzigtausend Mark wurden geboten für die deutsche Friedensfeder, das ist die Feder, mit der Kaiser Wilhelm den Friedensvertrag unterzeichnen würde; ein Leipziger Fabrikant versprach sich mit dieser Feder ein Riesengeschäft – ich konnte sie ihm nicht verschaffen. Die Wellen der Kriegskonjunktur gingen hoch.
Margot wurde davon mit weggespült. Wir hatten wieder eine neue Wohnung genommen, und ein zweites Kind war bereits unterwegs – die Tochter Dagny, die geboren wurde, als ich Margot bereits verlassen hatte und zu Cläre gezogen war, der Frau von Richard Öhring.
Ich bewegte mich in einer immer betonter werdenden Doppelexistenz, als wäre ich von einer geheimen Kraft abgeschirmt und gepanzert. Es wird nicht der Fall gewesen sein, mehr die Flucht vor der Gefahr, wieder in einen Strudel ungelöster und unlösbarer Fragen zu stürzen, in ein Nichts, aus dem ich nicht herauskommen würde. So seltsam das an dieser Stelle klingen mag, ich war nach all dem Feuerwerk der letzten Jahre erwachsen geworden.
Ich war sehr viel ruhiger geworden und ausgeglichener. Im Gegensatz zu meiner redaktionellen Tätigkeit neigte sich mein Interesse wieder mehr der Literatur zu. Ich besuchte Verleger und war die Nachmittage im Café des Westens anzutreffen. Einige der größeren Verleger zeigten Interesse, mich zu einem Autor für den Leserkreis des Verlages zu erziehen, vielleicht für später in Reserve zu halten. Ich hatte eine solche Unterredung mit Sammy Fischer, der mir sehr wohlgesinnt gewesen ist. Der Verlag suchte gerade einen neuen Standard-Autor. Oskar Loerke und Moritz Heimann hätten mich gern als Verlagsautor gesehen. S. Fischer war auch nicht abgeneigt. Er hat mir väterlich zugeredet, die Politik sein zu lassen, sie mehr innerlich zu verarbeiten und umzusetzen in gute Dichtung. Die Zusagen, die er von mir erwartet haben mag, habe ich verschluckt; ich blieb störrisch. Herr Fischer wollte durchaus mein Zutrauen gewinnen. Er zog aus der Schreibtischschublade das Frühstücksbrot, das er von zu Hause mitgebracht hatte, und gab mir die Hälfte ab über den Schreibtisch hinüber. Ich bin sehr einsilbig gewesen. Der andere Schriftsteller, der zur Auswahl stand, ist Otto Flake gewesen; Flake ist der Standardautor geworden.
Ich war viel mit meinem alten Freunde Max Herrmann-Neiße zusammen; eine Oase in der Wüste. Ich traf mit Theodor Däubler, dem von der Stadtverwaltung die doppelten Lebensmittelkarten zugebilligt waren, zusammen. An und für sich hätte das Däubler nicht nötig gehabt. Wo immer er in den größeren Restaurants am Kurfürstendamm erschien, die Kellner servierten ihm ohne Karten. Trotzdem haben wir auch noch in unserem Kreis Karten für Däubler eingesammelt.
In dieser Zeit erneuerte ich meine Bekanntschaft zu Else Lasker-Schüler, mit der ich schon früher auf den Aktionsabenden bekannt geworden war. Ich traf sie meist im Café des Westens. Sie saß dort viel allein, wie von allen verlassen. Sie war dankbar für jedes freundliche Wort.
Else Lasker-Schüler hatte jeden Kontakt zur Umwelt und den Vorgängen draußen in der Welt verloren. Der Krieg muss für sie etwas Unvorstellbares und auch völlig Unverständliches gewesen sein. Sie hat mich manchmal im Café aufgefordert, sie in ihre Wohnung zu begleiten. Ich erinnere mich an ein typisches Altberliner Zimmer, mit einem kleinen Podium am Fenster, wie das früher war in der guten alten Zeit, als die Bewohner dort ihre Blumentöpfe stehen hatten. Auf diesem Podium saß dann Else Lasker-Schüler auf einem einfachen Rohrstuhl und sah auf die Straße hinaus und in ihre Welt, die Kamelstraßen durch die fernen Wüsten, das seit Jahrtausenden angestammte Land des Prinzen von Theben. Sie sprach vor sich hin und überließ sich den bunten Träumen oder sie rezitierte Gedichte oder las aus Briefen vor, die sie durch Kuriere zu senden beschlossen hatte und die niemals abgeschickt worden sind. Der Besucher saß etwas abseits am Tisch in der Mitte des Zimmers und hörte zu, stundenlang und voller Ehrfurcht.
Читать дальше