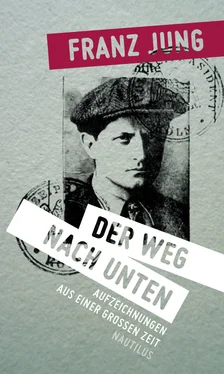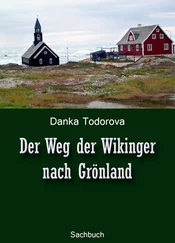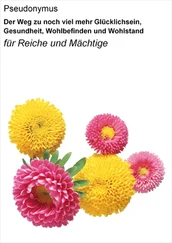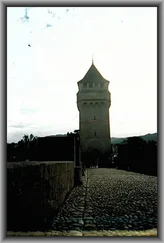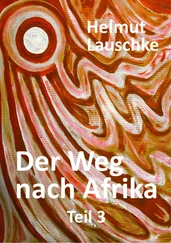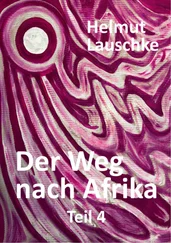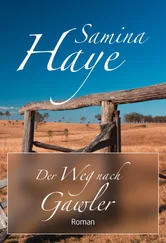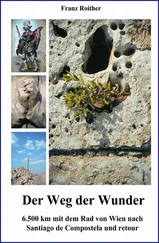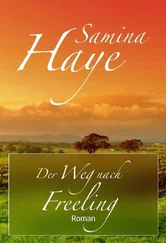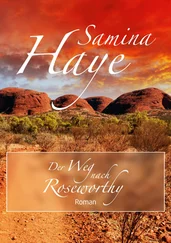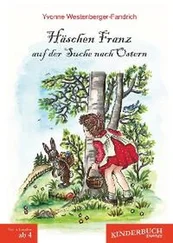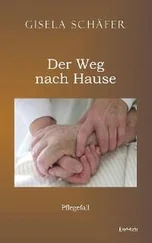In dem engeren Kreis um Franz Pfemfert und die Geschwister Ramm war Ludwig Rubiner die überragende Persönlichkeit. Sein Essay „Der Dichter greift in die Politik“ hat genau das getroffen, was wir alle damals gefühlt haben. Zu diesem Kreis gehörte Karl Otten, zeitweise Kurt Hiller, Carl Einstein, Sternheim und Landauer, und als gute Freunde, so zu sprechen, die großen Verleger Fischer, Kurt Wolff und Rowohlt, so seltsam das heute erscheinen mag, weiterhin Alfred Kerr und Maximilian Harden.
Das ist das Phänomen Pfemfert: Wie hat er diese enorme Aufgabe bewältigen können? – und den ganzen Weltkrieg hindurch … Wie sind die Gelder zusammengekommen, die Zeitschrift durchzuhalten? – zu denen dann noch die Kosten des Buchverlags hinzugekommen sind? Zwar zahlte die Aktion keine Honorare, aber das ist nicht das Entscheidende; vielleicht überhaupt nicht das Geld, sondern die Arbeit, der Briefwechsel mit den Autoren und den Hunderten von Leuten aus aller Welt, die technische Redaktionsarbeit der Herausgabe, der Drucklegung und des Versands … für jeden Fachmann gesehen, ein Phänomen.
Pfemfert hat nie irgendwelche Helfer gehabt, abgesehen von Alexandra Ramm, seiner Frau. Er wohnte in der Nassauischen Straße im Wilmersdorfviertel in Berlin in einem Hinterhaus im vierten Stock. Dort war eine Art Arbeitszimmer, und Pfemfert saß hinter einem Tisch vor einem Berg von Briefen und Manuskripten, die Zigarrenkiste mit dem Tabak vor sich, aus der er sich ständig die Zigaretten stopfte. Er war immer zu sprechen und für jeden, von frühmorgens bis spät in die Nacht. Die Tür war für jeden Besucher offen.
Ich will hier nicht verschweigen, dass ich mich in dem Aktionskreis nicht wohl gefühlt habe. Man behandelte mich mit einer an sich freundlichen Distanz. Und obwohl Pfemfert später im Kriege in rascher Folge meine Arbeiten herausgebracht hat, es sind diejenigen Bücher, die vielleicht Anspruch auf bleibenden Wert haben, wenn auch nur charakteristisch für eine eng begrenzte Epoche, so bestand in Wirklichkeit nur eine sehr lose Verbindung zwischen uns. Zu Ludwig Rubiner konnte ich bedauerlicherweise überhaupt keinen Kontakt gewinnen, und mit Carl Einstein werde ich kaum mehr als ein paar Worte gesprochen haben. Ich vermute heute, dass Franz Pfemfert diese meine Arbeiten, die zum größten Teil im Festungsgefängnis Spandau entstanden waren oder kurz nachher, wie die Romane „Sophie“, „Opferung“ und „Der Sprung aus der Welt“, geeignet gefunden haben muss, der Verflachung der Literatur im Kriege entgegenzuwirken – das Einzelschicksal des Menschen, besonders in der Beziehung zur Frau und der Umwelt, lässt den Krieg völlig ignorieren, der Krieg ist nicht viel mehr als ein lästiges und aufdringliches Gerücht –, aber gesprochen hat Pfemfert mit mir darüber nicht. Diese Arbeiten sind sogleich in dem allgemeinen Kriegsrummel mit untergepflügt worden. Sie haben heute einen gewissen Seltenheitswert im Buchhandel für ein paar Dutzend von Literaturbeflissenen, die sich über die Wurzeln des Expressionismus orientieren wollen.
Wenn Pfemfert sich bei der Herausgabe eine breitere Wirkung versprochen hat, so wird die Enttäuschung, die ja auch immer erst einige Jahre nachher ins Bewusstsein rückt, recht bitter gewesen sein.
Meine zwielichtige Stellung als Börsenkorrespondent, meine eigene Unsicherheit, mich entweder von der Börse oder der Literatur zu befreien, und die zur Schau gestellten Provokationen haben meine Eingliederung in den Aktionskreis nicht gerade erleichtert.
In dieses letzte Berliner Jahr vor Ausbruch des ersten Weltkrieges fiel meine Befreiungskampagne für Otto Groß.
Der Vater, ein Universitätsprofessor in Graz, Verfasser des „Handbuches für den Untersuchungsrichter“, ein internationales Standardwerk, hatte es sich in den Kopf gesetzt, den Sohn wieder auf die bürgerliche Existenz einer Privatdozentur an einer von ihm ausgewählten Universität zurückzuführen; wenn notwendig, mit Gewalt. Über die Vorgeschichte weiß ich wenig. Otto Groß selbst pflegte darüber nur in dem allgemeinen und erweiterten Rahmen des Vater-Sohn-Komplexes zu sprechen. Den letzten Anstoß soll ein Aufsatz gegeben haben, den Groß in einer psychoanalytischen Fachzeitung über den Vater zu veröffentlichen gedachte, ausgehend von einer Analyse des Sadismus in der gesellschaftlichen Funktion eines Untersuchungsrichters mit den Assoziationen zum Vater, der dieses Handbuch verfasst hatte, sowie die entsprechenden sadistischen Reflexe in seiner Stellung zur Familie und dem Sohn Otto. Irgendwie ist dieses Manuskript schon vor der Drucklegung in die Hände des Vaters gefallen oder diesem in die Hand gespielt worden – das war die Version von Otto Groß, der auch einen bestimmten Verdacht auf Personen aus seiner nächsten Umgebung hatte.
Aus dem latenten Unterton von gegenseitiger Abneigung entstand so der völlige Bruch. Der Vater Groß hatte vielleicht nur auf einen Anlass dieser Art gewartet. Er schlug zu mit der Autorität, die einem berühmten Professor der Rechtswissenschaften zur Verfügung steht, mit der Absicht, den Sohn dieses Mal endgültig zu vernichten. Vorher hatte sich der Vater von einem andern abgefallenen Freud-Schüler, dem Züricher C. G. Jung, ein Gutachten bestellt, worin dieser Jung seinen Kollegen Otto Groß als einen gefährlichen Psychopathen charakterisiert haben soll.
Gestützt auf dieses Gutachten hatte der Grazer Professor die Berliner Polizeibehörden ersucht, Otto Groß festzunehmen und an die österreichische Grenze zu bringen, wo er von den vom Vater mobilisierten Schergen in Empfang genommen werden sollte.
Otto Groß war kurz vorher nach Berlin gekommen, um sich eine neue Existenz aufzubauen, nachdem er auf eine geldliche Unterstützung durch die Familie nicht mehr rechnen konnte. Er hat bei uns gewohnt, und Margot und deren Mutter, die den Haushalt führte, haben ihn betreut.
Er wurde auch in meiner Wohnung verhaftet.
Ich hatte bisher den Auseinandersetzungen mit dem Vater und der Familie nicht allzu viel Aufmerksamkeit gewidmet. Mir hatte vorgeschwebt, Otto Groß selbst zunächst auf die Beine zu stellen, ihm eine Praxis aufbauen zu helfen und ihn zu wissenschaftlichen Arbeiten anzuregen, wofür sich ein Verleger bereits gefunden hatte. Auch die „Aktion“ brachte mehrere Aufsätze, die Groß in der Wohnung Pfemferts geschrieben hatte. Es schien auch langsam wieder bergauf zu gehen, es kamen neue Freunde. Überwunden werden mussten die tiefen Depressionen, in die Groß von Zeit zu Zeit noch verfiel. Dazu war mitfühlendes Verständnis notwendig, Hilfsbereitschaft und eine große Geduld – überraschend viele aus dem Aktions-Kreis, auch bisher sonst Fernstehende, waren dazu bereit.
Der Vorstoß des Vaters hat mich allerdings noch in ganz anderer Weise alarmiert. Um dem Ersuchen um Ausweisung bei der Berliner Polizei noch größeren Nachdruck zu geben, hatte der Grazer Professor angegeben, dass sein Sohn in die Hände von gefährlichen anarchistischen Elementen gefallen sei, vermutlich eine Erpresserbande, die frühere Untersuchungen des Otto Groß über Homosexualität ausnützen werden, ihn – den Vater – zu erpressen.
Ich erwähne das alles etwas ausführlicher in diesen Aufzeichnungen, weil ich damals noch fähig gewesen bin, zu einem Gegenschlag auszuholen; auch unter Anwendung jedes möglichen und geeignet erscheinenden Mittels. Allein diese Tatsache hat mir eine größere Selbstsicherheit gegeben, die noch lange Zeit nachher vorgehalten hat – insofern kann man diese Kampagne als einen Wendepunkt bezeichnen, der die nachfolgenden Jahre entscheidend mitbeeinflusst hat.
Das von dem Vater eingeschlagene Verfahren bot eine gute Angriffsfläche – das Ansuchen um Ausweisung stellte eine ungehörige Beeinflussung der Polizeibehörde eines anderen Landes dar, die ihrerseits an eine bestimmte Prozedur, die einer solchen Ausweisung vorangehen muss, gesetzlich gebunden ist. Der Professor glaubte dies, auf seine Autorität gestützt, ignorieren zu dürfen. Die preußischen Polizeibehörden haben ihm in seiner Annahme recht gegeben. Damit rückte der Fall bereits auf zu einer Kernfrage der Innenpolitik: Welches Recht haben die Ausländer in Preußen-Deutschland überhaupt? Hinzu kam noch, dass die Verdächtigungen, die der Professor benutzt hatte, nur sehr vage waren. Er hatte sich auch nicht einmal die Mühe genommen, zum Mindesten durch eine Geste, sie beweisen zu wollen.
Читать дальше