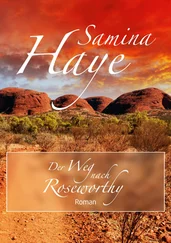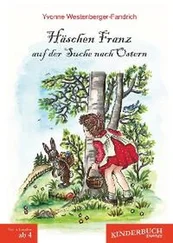1 ...8 9 10 12 13 14 ...28 Was fehlte, waren die Menschen, die Freunde, die Kameraden, die wirklich Gleichgesinnten, vielleicht auch die Mädchen, obwohl ich kein Interesse hatte, denen hinterherzusehen oder sie gar anzusprechen. Die Leute um den Caféhaustisch waren mir im Grunde fremd; sie blieben schemenhaft, Figuren, mit denen man über den Kooperationsstaat diskutieren konnte – das gab es damals schon, Lenkung der Wirtschaft nach Säulen der Berufe durch eine obere Spitze als die politische Regierungsform, für uns damals noch ein Affront gegen Schmoller, dessen Vorlesungen wir alle besuchten –, aber eben nicht mehr, und dann der abendliche Fußmarsch nach Leutzsch … warte deine Zeit ab und alles wird werden. Zu der Tasse Kaffee wurde sehr viel Wasser getrunken, und es reichte sehr selten zu einem Stück Kuchen, das heißt, das knappe Geld war genau auf den Pfennig eingeteilt.
Hätte es so bleiben sollen? – ich machte einige schüchterne Versuche, den Leuten etwas näher zu kommen, der eine von dieser Tischrunde ist Rechtsanwalt in Apenrode geworden und hat in der dänischen Politik lange eine Rolle gespielt. Ich habe ihm eines Tages in einer unverständlichen und völlig überflüssigen Laune Gottfried Kellers Gesammelte Werke geschenkt, von dem Gerstenberg mir besorgt, auf Abzahlung bei seiner Firma; nichts ist weiter daraus entstanden; ich habe allerdings auch später die Bücher nicht bezahlt. Der andere ist Pastor geworden an der Kirche in Naumburg, wo sein Vater als Küster angestellt gewesen ist. Ich habe den Vater auch kennengelernt, damals, als plötzlich dieses Idyll in Leipzig durch eine kleine Bombe zerstört worden war, damals, als ich es dann in Leipzig nicht mehr aushalten konnte und wer weiß wohin ausgerissen wäre, hätte mich nicht dieser Bekannte an die Hand genommen und nach Naumburg zu Besuch über das Wochenende zu seinem Vater gebracht, der an einer der Kirchen dort Küster war, Chordiener und die Orgel spielte.
Der Blitz kam aus heiterem Himmel. In einer der von der Freien Studentenschaft veranstalteten Massenversammlungen hielt der Graf v. Hoensbroech, ehemaliger Jesuitenzögling, die übliche Brandrede gegen das Papsttum. Schließlich ging mich das alles nichts an. Ich besuchte solche Veranstaltungen der Freien Studentenschaft genau gesagt aus Langeweile und aus dem Bedürfnis nach Abwechslung. Ich hörte den Grafen vor dieser Massenversammlung von vielleicht zwei- bis dreitausend Studenten gegen den Papst losdonnern. Weder die Lautstärke noch die Argumente zündeten, obwohl sicherlich alle die Anwesenden dem Grafen zugestimmt haben. Es sprachen in der folgenden Diskussion noch ein paar ältere Studenten und hieben in die gleiche Kerbe, nur noch dümmer und, wenn möglich, noch aufgeblasener.
Auch ich hatte mich zu Wort gemeldet. Die Stimmung war noch flauer geworden, lustlos zum Gähnen. Ich wusste im Grunde nicht, was ich sagen wollte – wahrscheinlich stimmte ich mit dem Grafen überein, aber das spielte jetzt keine Rolle. Technisch – schien es – hatte ich den Grafen anzugreifen. Ich musste ein grobes Geschütz auffahren, und ich legte los.
Aus dem katholischen Religionsunterricht und der allgemeinen Atmosphäre des heimatlichen Katholizismus war bei mir nicht mehr viel übrig geblieben; umso gröber konnte ich loslegen … wozu erst Argumente, lass das Herz sprechen.
Ich hatte großen Erfolg. Die Versammlung wurde aufgeregt. Neue Wortmeldungen, alle zwar gegen mich, aber mit Ehrenbezeugungsfloskeln. Die ehrbaren Gegner kreuzen die Degen in ritterlicher Tradition und so. Am begeistertsten war der Graf von Hoensbroech selbst, der eine direktere Zielscheibe gefunden hatte, als den immerhin recht weit entfernten Papst. Ich wurde am Saalausgang von allen Seiten aus beglückwünscht. Ich wusste selbst nicht, was eigentlich los war. In dem Mitteilungsblatt der Freien Studentenschaft war die erste Seite dem tapferen jungen Studenten gewidmet, der gegen eine überwältigende Übermacht seine religiöse Weltanschauung verteidigt hatte.
Das wurde mir zu viel. Ich ließ an dem erwähnten Caféhaustisch an einem der nächsten Tage die Bemerkung fallen: es habe sich da überhaupt um keine Weltanschauung gehandelt, ich hätte in der Diskussion lediglich aufgrund einer Wette gesprochen, und sie alle würden bezeugen können, ich hätte diese Wette gewonnen. Mehr sei nicht dahinter. Dies sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Schon am folgenden Tag wurde ich im Minerva von allen gemieden. Ich war aus, fertig. Die Studentenzeitung bereitete einen neuen Artikel, diesmal gegen mich, vor, und selbstverständlich meinen Ausschluss aus der Freien Studentenschaft.
Da nahm mich der Theologiestudent an die Hand und lud mich ein über das Wochenende nach Naumburg in die Küsterwohnung. Vater und Sohn waren einander sehr zugetan, die Mutter war schon längere Zeit vorher gestorben, ältere Geschwister waren außer dem Haus. Der Sohn lebte für den Vater und der Vater wahrscheinlich für den Sohn. Beide hatten das Herz auf der Zunge, besonders dem Gast gegenüber. Eine Insel des Friedens und der Zuversicht. Uns wird heute eine solche Zeit, vielleicht sind in Wirklichkeit schon Jahrhunderte darüber vergangen, als geschichtliches Märchen aufgetischt. Literaten haben sich der Sache bemächtigt … es sollte jedenfalls darüber nicht so viel geschrieben werden.
Ich spielte in Naumburg zur großen Freude des Küsters mit dem Sohn abwechselnd die Orgel; – ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich auch in Neiße in der Kreuzkirche die Orgel oft vertretungsweise gespielt habe. Meist in den wöchentlichen Schulmessen am Morgen, zum Beispiel im Dezember. Ich habe dann, erinnere ich mich, die Register gezogen in die Überleitung zum Choral: Rorate coeli de super … Tauet, Himmel, den Gerechten …
Vater und Sohn sind beide aus meinem Leben verschwunden. Beide habe ich nicht mehr wiedergesehen, auch keine Verbindung mehr gehalten.
Ich habe es indessen noch einmal versucht, mich in Linie zu bringen. Vorbereitet in den Ferien durch zwei meiner Mitschüler, wurde ich im folgenden Semester Mitglied der Leipziger Burschenschaft Arminia. Von dieser Zeit ist nichts im Gedächtnis geblieben, nicht einmal die Gesichter der Kommilitonen, mit denen ich zweimal die Woche im Haus der Burschenschaft an einer langen Tafel saß, den Sonntagvormittag den Farbenbummel auf dem Thomasring bestritt, den Fechtboden regelmäßig besuchte und am Anfang und Schluss des Semesters an einem Ausflug mit Damen teilzunehmen hatte. Ich besuchte in dieser Zeit die juristischen Kollegs, soweit ich sie nachholen konnte. Ich muss mich schrecklich gelangweilt haben, aber es geschah sonst weiter nichts. Ich wurde ein leidlicher Fechter, besser geeignet für die Bestimmungsmensuren als für die Kontrahagen auf schwere Säbel – dafür war mein Arm im Verhältnis zur sonstigen Körpermasse zu kurz; ich bezog regelmäßig Prügel.
Ich wechselte im nächsten Semester über nach Jena in die Burschenschaft Germania, zum Teil, weil ich mich dort besser auf meine Säbel-Kontrahagen vorbereiten konnte, mehr aber, weil ich eine breitere Gesellschaft, offenere Kameradschaft und Zusprache dort zu finden hoffte. Darin wurde ich sehr enttäuscht. Unter den dreißig bis vierzig Aktiven war auch nicht ein einziger, mit dem ich irgendwelche Ansichten oder Erlebnisse auszutauschen gehabt hätte. So würde ich mir das Leben in einer Kaserne vorgestellt haben. Es war alles genau geregelt. Es wurde kommandiert und zur Ordnung gerufen. Möglicherweise ist eine solche Erziehung für eine spätere Eignung im Beruf ganz angebracht. Ich konnte mir indessen keinen Beruf ausdenken, wo ich der stützenden Hilfe dieser Kommilitonen bedürfen würde. Es wurde ein großes Missverständnis, auch dann noch, als ich mich Hals über Kopf in den Betrieb stürzte, also Sänger unter den Singenden, Schläger unter den Schlagenden und Säufer unter den Pflichtsaufenden geworden war. Es war eben ein Missverständnis.
Читать дальше