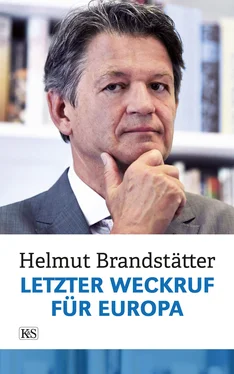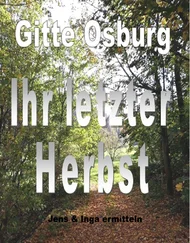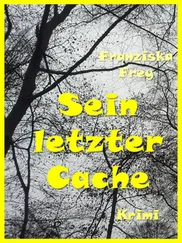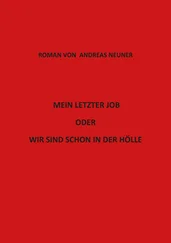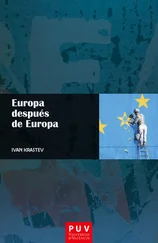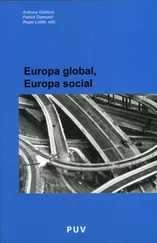KAPITEL 3
GESCHICHTE
KRIEGE, FRIEDEN UND DAS SPIEL MIT EMOTIONEN
In keinem anderen Kontinent sind auf so engem Raum so viele unterschiedliche Sprachen, Kulturen und Lebensweisen entstanden, keine Gegend auf der Welt wurde so oft von Völkerwanderungen verändert. Das günstige Klima und die vielen miteinander verbundenen Wasserstraßen haben diese Mobilität begünstigt. Später sind von hier aus Forscher und Abenteurer in großer Anzahl aufgebrochen, um die ganze Erde zu entdecken, immer neugierig, manchmal aber auch nur gierig.
Aber seit Menschen in Europa lebten, wurde hier Krieg geführt: um Raum für den Anbau von Lebensmitteln, später um Grenzen, Religionen oder einfach zur Demonstration von Macht. Schon Ausgrabungen aus der Steinzeit erzählen von grausamen Auseinandersetzungen bis hin zum Kannibalismus. Vor 45.000 Jahren kam der Homo Sapiens nach Europa; vor 8.000 bis 9.000 Jahren wurden die Menschen sesshaft, lebte von Ackerbau und Viehzucht und verwendete keramische Gerätschaften. Seit dieser Zeit, der sogenannten neolithischen Revolution, sind die ältesten bäuerlichen Kulturen in Mitteleuropa nachweisbar. In Herxheim in der Pfalz fand man etwa 450 Schädel, Zeugen roher Gewalt, die rund 5.000 v. Chr. ausgeübt wurde. Zur gleichen Zeit gab es in Niederösterreich das „Massaker von Schletz“. In Aspern an der Zaya wurden die Überreste von rund 200 Menschen gefunden, die durch Hiebe auf den Kopf getötet worden waren, wie die Schädelfunde zeigen.
Gründe für einen Krieg gab es immer. Erst vor wenigen Jahren wurden am Ufer des Flusses Tollense im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Spuren kriegerischer Auseinandersetzungen gefunden, die in der Bronzezeit stattgefunden hatten. Archäologen haben anhand der Knochenfunde eruiert, dass hier um 1.300 vor Christi Geburt rund 5.000 Menschen mit Schwertern und Pfeilen aus Bronze zu Fuß und auf Pferden miteinander gekämpft haben. Damals veränderte sich das Klima, die Lebensbedingungen im Norden wurden schlechter, Ressourcen entsprechend knapp. Bei diesem Krieg ging es also offenbar noch um das nackte Überleben eines Stammes; später schickten Herrscher ihre Untertanen aus reiner Machtgier auf die Schlachtfelder, oft verbrämt durch angebliche religiöse Ziele, fanatisiert durch nationalistische Gesänge oder eingebildete „rassische“ Überlegenheit. Von 7.000 v. Chr. bis ins Jahr 2001, als die Jugoslawienkriege zu Ende ging, sind Menschen in Europa also gewaltsam gegeneinander vorgegangen, und schon während der Friedensverhandlungen wurde meistens die nächste Schlacht vorbereitet.
Der Sprecher des österreichischen Bundesheeres, Oberst Michael Bauer, kam irgendwann auf die Idee, auf der Plattform Twitter, wo Streit auch nicht immer zivilisiert abläuft, mit historischen Friedensschlüssen für historische Bildung zu sorgen. Der erste belegte Friedensvertrag geht auf das Jahr 2.740 v. Christus, auf das Sumererreich zurück, das erste Friedensabkommen in Europa wurde 449/448 v. Chr. geschlossen: der Kalliasfrieden zwischen dem Attisch-Delischen Seebund und dem persischen Achämenidenreich, das nach Europa expandiert war. Der griechische Heerführer Kallias und König Artaxerxes beendeten dadurch die Perserkriege, vorläufig zumindest. Alexander der Makedonier marschierte 334 v. Chr. wieder gegen die Perser und wurde durch die vielen Kriege in seinem kurzen Leben zu Alexander dem Großen. Der jüngste Friedensvertrag, paraphiert am 21. November in Dayton, Ohio, und unterzeichnet am 14. Dezember 1995 in Paris, beendete die Kriege nach dem Zerfall Jugoslawiens zwischen Serbien, Kroatien und Bosnien.
Der Holocaust veränderte (vorerst) alles
In den Ersten Weltkrieg waren die europäischen Großmächte und ihre Führer, die noch dazu großteils miteinander verwandt waren, wie Schlafwandler getaumelt, so der Titel des Buches des Historikers Christopher Clark aus dem Jahr 2012. In über vier Jahren starben 17 Millionen Soldaten auf den Schlachtfeldern und Zivilisten an den Kriegsfolgen. Im November 1918 sah die Welt anders aus, drei Reiche waren untergegangen, das des Zaren, das der Habsburger und das der Hohenzollern. Die Friedensverträge, geschlossen in den Pariser Vororten, wollten mehr bestrafen als befrieden. Manche Historiker sehen die Zeit von 1914 bis 1945 wie einen großen Krieg, aber Hitler wollte mehr als die Revanche für einen ungerechten Frieden, er wollte auch mehr als „Lebensraum im Osten“. Die Vernichtung des Judentums war sein Ziel, und deren Durchführung war so erschreckend genau geplant wie der Fahrplan der Deutschen Reichsbahn. Die Amerikaner kamen spät, aber sie kamen. Den Holocaust konnten auch sie nicht mehr verhindern. Dass eine Kulturnation wie die Deutschen dazu fähig war, beschäftigt noch heute das Gewissen der deutschen Politik, und auch das offizielle Österreich hat spät, aber doch Verantwortung übernommen. 70 Millionen Tote kostete der Zweite Weltkrieg, 6 Millionen Juden wurden ermordet, zum Teil nach schrecklichen Qualen in den Vernichtungslagern, aber auch nach erniedrigenden Aktionen durch Zivilisten. Es ist und bleibt ein großes Wunder, dass die Todfeinde vieler Jahrhunderte schon kurz nach dem Krieg mit dem größten Friedenswerk der europäischen Geschichte begannen, indem sie die Verfügung über Kohle und Stahl unter eine gemeinsame Verwaltung stellten. Seither ist Versöhnung ein großes europäisches Thema, mit dem sich freilich viele am Balkan noch schwertun.
Der Zerfall Jugoslawiens: Kein Ende der Geschichte
Die Jugoslawien-Kriege zeigten, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der kommunistischen Ideologie nicht das Ende der Geschichte gekommen war, wie der amerikanische Politologe Francis Fukuyama geschrieben hat. In einem Essay aus dem Jahr 1989 und seinem berühmt gewordenen Buch mit ebendiesem Titel drei Jahre später stellte er die These auf, dass sich liberale Demokratie und Marktwirtschaft endgültig durchgesetzt hätten. Immerhin, im November 1990 wurde die Charta von Paris unterzeichnet. Darin riefen die Staaten Europas, die auf ihren Territorien nicht nur eigene Massenvernichtungswaffen, sondern auch Bomben und Raketen der Russen und Amerikaner stationiert hatten, den ewigen Frieden für den kriegerischen Kontinent aus. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die seit November 1972 in Helsinki an der Respektierung von Staaten, Grenzen, aber auch Menschenrechten arbeitete, war damit nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall des Ostblocks zu ihrem friedlichen Ende gekommen.
Umso ernüchternder waren die Jugoslawien-Kriege, die im Sommer 1991 in Slowenien mit dem 10-Tage-Krieg begannen und erst 2001 mit dem albanischen Aufstand in Mazedonien endeten. Die Zahl der Toten in diesen blutigen Bürgerkriegen wird auf rund 200.000 geschätzt. 2,4 Millionen Menschen flüchteten vor Verfolgung aus ihrer Heimat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden vor einem internationalen Strafgerichtshof verhandelt, Täter wurden abgeurteilt. Viele Wunden sind auch heute noch offen, wie man bei jedem Gespräch in einem der betroffenen Länder erfährt. Wir müssen es so klar aussprechen: Krieg am Balkan kann es wieder geben. Unverbesserliche Nationalisten sprechen bereits von Grenzverschiebungen und dem Austausch von Bevölkerungsgruppen. So etwas geht nie friedlich. Und alle schauen weg. Ja, die Sonntagsreden gibt es, in denen für die Aufnahme der Westbalkanländer in die EU geworben wird. Und dann blockierte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Herbst 2019 die Aufnahmegespräche mit Albanien und Nordmazedonien. Angeblich war er beleidigt, weil seine Kandidatin für die EU-Kommission nicht akzeptiert wurde. Auch das ist Europa. Aber im Frühjahr 2020 gab es eine Wendung zum Positiven. Am 24. März beschlossen die EU-Staaten die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit den beiden Ländern.
Читать дальше