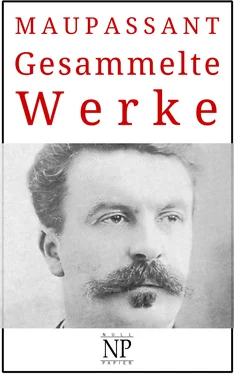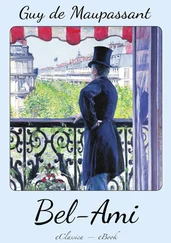Der Baron, welcher seiner ungebundenen Natur und seiner ganzen Erziehung nach mit den Anschauungen und Vorurteilen seiner Standesgenossen wenig harmonierte, kannte die Familien in der Umgegend kaum dem Namen nach und befragte jetzt den Vicomte darüber.
»O, es gibt wenig Adel hier im Lande« antwortete Herr de Lamare ungefähr in demselben Tone, wie er gesagt haben würde, es gebe wenig Kaninchen an der Küste. Hierauf begann er mit Einzelheiten. Nur drei Familien wohnten ziemlich in der Nähe: der Marquis de Coutelier, sozusagen der Chef des Adels in der Normandie; der Vicomte und die Vicomtesse de Briseville, von ausgezeichneter Abstammung, die sich aber so ziemlich von Allen zurückzogen. Endlich sei noch der Graf Fourville da, eine Art Blaubart, dessen Frau vor Gram über sein Leben gestorben sei. Er lebte ausschliesslich der Jagd in der Umgebung seines Schlosses la Vilette, welches mitten in einem großen Teiche liege. Einige Emporkömmlinge, die aber keinen Zutritt zur Gesellschaft fänden, hätten hier und da sich angekauft. Der Vicomte kannte sie auch nicht.
Nach einiger Zeit verabschiedete sich der junge Mann, nicht ohne einen letzten Blick auf Johanna geworfen zu haben, der wie ein besonders zärtliches sanftes Lebewohl aussah.
Die Baronin fand den Vicomte sehr nett und vor allem sehr »comme il faut.« »Jawohl, ganz gewiss«, antwortete ihr Gatte, »es ist ein sehr wohlerzogener junger Mann.«
Man hatte ihn für die nächste Woche zum Diner eingeladen. Von da an war er ein sehr häufiger Gast im Schlosse.
Meistens kam er gegen vier Uhr Nachmittags, suchte die Baronin in »ihrer Allee« auf und bot ihr den Arm, um sie bei »ihrer Übung« zu unterstützen. Wenn Johanna gerade keinen Ausflug machte, stützte sie die Baronin von der anderen Seite und alle drei gingen nun langsamen Schrittes in der geraden Allee hin und her. Er sprach fast niemals mit der jungen Dame. Aber sein dunkler verschleierter Blick traf häufig das achatblaue Auge Johannas.
Mehrmals gingen sie auch beide in Begleitung des Barons nach Yport.
Als sie eines Abends am Ufer standen, trat Papa Lastique auf sie zu, seine Pfeife im Munde, deren Fehlen auffallender gewesen wäre, als das Fehlen seiner Netze.
»Bei diesem Winde, Herr Baron,« meinte er, »müsste man morgen eigentlich nach Etretat fahren. Wir kämen bequem hin und zurück.«
»Ach Papa!« sagte Johanna, die Hände faltend, »das wäre zu herrlich.«
»Machen Sie mit?« wandte sich der Baron an den Vicomte. »Wir könnten da unten frühstücken.«
Da dieser zustimmte, wurde die Partie sofort beschlossen.
Mit dem Morgengrauen war Johanna schon auf und wartete voll kindlicher Ungeduld auf ihren Vater, der etwas langsam im Anziehen war. Dann gingen sie durch den frischen Morgentau erst an dem großen Rasenplatz vorbei, hierauf durch das Holz, welches vom Gesang der Vögel widerhallte. Der Vicomte und Papa Lastique sassen auf einer Schiffswinde.
Zwei andere Schiffer halfen bei der Abfahrt. Ihre Schultern gegen den Schiffsrand stemmend, schoben sie aus Leibeskräften; aber sie brachten den Kiel nur langsam von dem kiesigen Grunde ab. Lastique schob einige mit Fett beschmierte Rollen unter den Kiel, dann nahm er seinen Platz wieder ein und ließ mit eigentümlicher Modulation sein unaufhörliches »Ahoh hopp« erklingen, mit dem er die Bewegungen seiner Genossen leitete.
Als aber dann der Boden schräger wurde, kam das Boot plötzlich in eine rasche Bewegung und glitt über die Kiesel mit einem Tone, als würde ein Gewebe zerrissen. Jetzt ruhte es auf dem leicht gewellten Wasser und alles nahm auf den Bänken Platz. Dann schoben die beiden Schiffer, die am Ufer geblieben waren, es mit einem mächtigen Stoss in die See.
Eine leichte anhaltende Brise rief auf der Oberfläche des Wassers kleine schaumige Wellen hervor. Das Segel wurde gehisst, es blähte sich mehr und mehr, und von den Wellen gewiegt, bewegte sich die Barke langsam vorwärts.
Man fuhr anfangs weiter in See. In der Ferne verschwamm das Blau des Himmels mit dem Ozean. Wenn man zum Lande herüberschaute, so bemerkte man deutlich den tiefen Schatten, den die hohe Küste auf das Meer zu ihren Füssen warf, während man durch die Vertiefungen zwischen den einzelnen Hügeln hindurch die darunterliegenden Rasenflächen im vollen Sonnenlichte sah. Drüben im Hintergrunde hoben sich braune Segel von dem weißen Flecken ab, den Fecamp bildete, und fern da unten ragte ein Felsen empor, der wie ein Elephant aussah, dessen Rüssel ins Meer getaucht ist. Das war das sogenannte kleine Tor von Etretat.
Johanna, der das Schaukeln der Wogen anfangs etwas unheimlich war, hatte mit der einen Hand den Schiffsrand gefasst und blickte in die Ferne; es schien ihr, als ob es nur drei wirklich schöne Dinge in der Welt gäbe: die Sonne, den Himmelsdom und das Wasser.
Niemand sprach ein Wort. Papa Lastique, der das Steuerruder führte und das Segeltau hielt, nahm hin und wieder einen Schluck aus der Flasche, die er unter seinem Wams geborgen hatte. Dabei rauchte er unablässig seine nie verlöschende Pfeife, aus der fortwährend eine leichte blaue Dampfwolke aufstieg, während eine zweite aus seinem rechten Mundwinkel hervordrang. Man sah den Schiffer niemals die Pfeife von Neuem anzünden oder frisch stopfen, die, aus weißem Ton gebrannt, durch den langen Gebrauch schwarz wie Ebenholz geworden war. Nur hin und wieder nahm er sie aus dem Munde, um aus demselben Winkel, wo sonst der Rauch hervordrang, den braunen Saft in einem weiten Bogen ins Meer zu schleudern.
Der Baron, der vorn sass, vertrat die Stelle eines Bootsgehilfen und überwachte das Segel. Johanna und der Vicomte sassen nebeneinander und waren alle beide etwas verlegen. Nur hin und wieder trafen sich, wie von magischer Gewalt angezogen, ihre beiderseitigen Blicke; hatte doch zwischen ihnen sich schon im Stillen jene flüchtige zarte Zuneigung entwickelt, welche bei jungen Leuten so leicht entsteht, wenn der männliche Teil nicht hässlich und der weibliche hübsch ist. Sie waren glücklich, bei einander zu sitzen, vielleicht weil eins an den andren dachte.
Die Sonne stieg immer höher, als wollte sie von oben her das unter ihr ausgebreitete weite Meer betrachten. Wie in einer Art von Koketterie hüllte sie sich in einen leichten Nebelschleier, an dem sich ihre Strahlen brachen. Es war ein durchsichtiger Schleier, sehr niedrig, goldig, der nichts verbarg, aber alles in einem sanfteren Lichte erscheinen ließ. Allmählich nahm der Glanz des Himmelsgestirnes zu, der Nebel senkte sich tiefer und als die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hatte, verschwand er gänzlich. Das Meer, jetzt glatt wie ein Spiegel, glitzerte in dem strahlenden Lichte.
Читать дальше