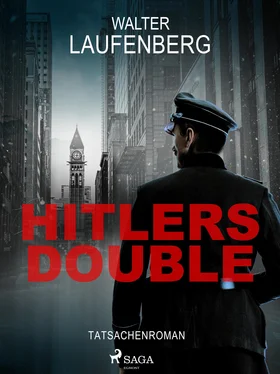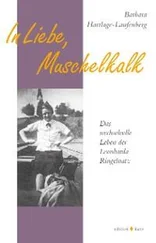„Die Totale können wir nicht brauchen. Die Totale ist nichts fürs Fernsehen. Dafür ist der Bildschirm zu klein. Das gäbe ja nur noch Fliegenschiss auf der Mattscheibe.“ Anthony erklärt selbst dann noch weiter, wenn man ihm nicht widerspricht und sogar zunickt. „Wir machen in Porträtfotografie. Da kann man die einzelnen Arten und ihre charakteristischen Unterschiede ansprechen.“
„Aber ich kenne nichts von diesen Arten. Wie soll ich den Film texten?“
„Mache ich schon. Ich bin gewohnt, daß kein Reporter eine Ahnung hat.“
„Und wozu bin ich dann überhaupt mitgefahren?“
„Das weiß ich auch nicht.“
Wir meiden die offiziellen Beobachtungsplätze, wo sich die Touristen drängen, und fahren direkt ins Sperrgebiet hinein. Anthony zeigt stolz seine Sondererlaubnis.
Drei Tage nur Vögel, da findet man es schon erholsam, mit einem Sonderling sprechen zu können. Wie ich versuche, ihn aufzubauen - mit den bewundernden Bemerkungen, daß er ja bei Kelowna TV ein alter Routinier ist und daß er ein ganz besonderes Händchen für Tiere hat -, entsteht tatsächlich so was wie Vertrautheit. Wenigstens für einen Moment. Während ich mich noch wundere, mit was für simplen Tricks man seine Mitmenschen aufschließen kann, wie mit einem gebogenen Draht als Nachschlüssel, werde ich hellhörig. Was hat Anthony da gesagt? Pineladder hat die Bemerkung gemacht: Den Harrison muß ich mal für ein paar Tage aus dem Verkehr ziehen? In der Redaktionssitzung hatte er gesagt: „Wir werden Sie ganz sicher die nächsten drei Tage nicht hier sehen.“ Das paßt zusammen.
„Und wozu das?“
„Was weiß ich“, will Anthony das Gespräch abbrechen. Er wendet sich wieder seiner Kamera zu, setzt ein anderes Objektiv auf. Ein Supertele von Unterarmlänge.
„Sie wissen mehr als Sie zugeben.“
„Das mag schon sein. Aber alles nur Belangloses. Eben was man so von seinen Mitmenschen zu hören kriegt.“
„Nämlich?“
„Na, beispielsweise so ein Reportertratsch. Mark Evans, der Starreporter vom ‘Kelowna Morning’, hatte ein Gespräch mit Pineladder.“
„Ach. - Wieso? Und wann? Und worüber?“
„Nur mal langsam. Wir spielen doch hier nicht Reporter und Interviewopfer.“
„Die Sache ist für mich äußerst wichtig, Mister Anthony. Deshalb sagen Sie mir bitte, wie es zu diesem Gespräch kam und um was es ging.“ Zu dumm, daß ich niemals zuvor mit diesem komischen Anthony das Gespräch gesucht habe. So kann ich ihn nicht einfach mit Fred anreden, bin auf dieses distanzierte Mister Anthony angewiesen. Einmal so richtig mit ihm einen trinken, das kann man ja auch nicht.
„Die beiden golfen gelegentlich zusammen. Und wenn ich Pineladder richtig verstanden habe, ging es um Sie.“
Mark Evans muß ihm gesagt haben, weswegen ich ihn aufgesucht habe. Was sonst? Also weiß mein Abteilungsleiter, daß ich weiterhin an dem Fall arbeite, von dem er mir die Finger zu lassen geraten hatte. Und er sagt mir nichts. Er schmeißt mich nicht raus. Er hat vermutlich auch nichts nach oben gegeben, sonst wäre ich schon draußen. Er schickt mich nur ins Abseits. Ich soll ein paar Tage nicht zu sehen sein - und nicht weiter recherchieren können. Das ist sehr nobel gehandelt. Muß ich ihm hoch anrechnen. Aber wenn er glaubt, damit Erfolg zu haben, wenn er glaubt, mich auf diese Weise von dem Fall abzubringen, dann täuscht er sich gewaltig.
Fred Anthony ist schon wieder beim Filmen. Seine Kamera hat er durch eine riesige Kunststoffhülle - mit Dämmstoffen ausgekleidet, ein etwas komisch aussehender Eigenbau - völlig geräuschlos gemacht. Da kann ein Vogel einen Meter vor dem Objektiv sitzen, er wird es nicht hören, wenn die Kamera losschnurrt.
Was lehren mich die Vögel? - Sie wissen, wann es Zeit ist aufzubrechen, und sie wissen, wohin sie sich wenden müssen. Und so einheitlich sie aussehen, sie selbst können sich unterscheiden. Sie erkennen, wer zu ihnen gehört und wer nicht. So muß ich auch die Altnazis erkennen können. Wenn sie auch nicht beringt sind. Irgendwas muß an ihnen sein, was dem Ring entspricht, irgendeine Prägung, irgendeine Gemeinsamkeit, ein Kainszeichen auf der Stirn. Ich muß nur genauer hinschauen. Und die Hartnäckigkeit und Engelsgeduld eines Tierfilmers brauche ich.
Es scheint nicht viele Deutsche oder Österreicher zu geben, die sich in unsere Welt verlaufen haben. Bisher habe ich nur von einem einzigen gehört. An der Theke, in harmloser Blabla-Recherche. Der Mann sammelt Schlüssel. Seine Überzeugung: Wer alle Schlüssel der Welt hat, dem steht die ganze Welt offen. Nein, das sei kein Hobby, hatte er sich verteidigt, das sei ihm ein Bedürfnis. Im übrigen auch nicht so teuer wie ein Hobby. Es liegen doch überall Schlüssel herum, die nicht mehr gebraucht werden. In jeder Wohnung. Man muß nur herumfragen. „Denn Schlüssel haben ein längeres Leben als Schlösser“, hat er mich bierselig aufgeklärt. „Meist tun die Schlösser es schon bald nicht mehr. Schlüssel sind das, was von uns übrigbleibt, und nicht die Schlösser. Ist das nicht beruhigend?“ Als sein innerer Bierpegel die Hochwassermarke erreicht hatte, verriet er mir, daß er jahrelang gesessen habe.
„Damals. Daheim. In Österreich.“
„Aha, dann bedeutet einem ein Schlüssel natürlich viel.“
„Viel? - Quatsch viel. - Alles, Mann. Denn Schlüssel heißt Freiheit.“
Wann er gesessen habe, wollte ich wissen. - Im Krieg. - Wirklich im Krieg und nicht nach dem Krieg?
„Quatsch nach dem Krieg. Da waren wir doch befreit. Plötzlich waren die Wachmannschaften weg. Und die Amerikaner haben das Lagertor ganz weit aufgemacht. Sperrangelweit aufgemacht.“
Ein Naziopfer also. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Ich suche Täter, nicht Opfer. Ist doch immer dasselbe: Wen interessieren schon die Opfer. Die Täter sind die tolleren Figuren. Ich werde weiter herumfragen.
Und heute Abend gehe ich zu Fuß über die Pontonbrücke zum Westufer des Sees. Ein Spaziergänger, das ist unverfänglich. Nein. Das geht nicht. Das wäre die allerauffälligste Art, mich dem Haus des Deutschen zu nähern. Wer geht schon zu Fuß? Aber mit meinem Wagen möchte ich auch nicht hinfahren. Da könnte sich jemand meine Autonummer merken oder zumindest den Typ und die Farbe. Aber so einen roten alten Ford haben doch viele Leute. Trotzdem schlecht.
Am frühen Abend bin ich bei einem Rollerverleih. Ich habe meine alte Lederjacke an und einen Fotoapparat vor dem Bauch hängen, kriege vom Geschäftsführer des Unternehmens einen Integralhelm übergestülpt und setze mich auf den Motorroller. Wie ein Tourist fahre ich langsam und mit vielem Hin- und Herschauen die Benvoulin Road hoch, biege dann nach links ab in die Harvey Avenue und bin gleich drauf auf der Pontonbrücke. Drüben am Hang kann ich das Haus schon sehen, das mir meine Kneipenbekanntschaft beschrieben hat. Das da, das muß es sein. In halber Höhe, mit herrschaftlichem Blick über den Okanagansee. Das habe ich bisher nie bewußt wahrgenommen. Dabei ist es ein Haus, das so wenig in diese Gegend paßt, wie ein Kamel ins Polareis. Ein schweres, weit über die Hauswände hinausgezogenes Dach, mit Holzschindeln gedeckt, auf denen einzelne Felssteine liegen. Ein stumpfwinkliger, behäbiger Giebel, unten weiß getüncht, oben aus dunklem Holz, mit zwei Reihen Balkons übereinander, die über die ganze Breite gehen. Eine Balkonverkleidung aus schnörkelig geschnitzten senkrechten Brettern. Und alles voller Blumenkästen, aus denen eine offenbar liebevoll gepflegte Blütenpracht weiß und blau überquillt.
Bayerischer Stil, so hat er das genannt, mein Mann an der Theke. Bayerischer Stil. Na, meinetwegen. Seinen Namen habe ich schon vergessen. Er hat sich den falschen Namen, den ich ihm genannt habe, hoffentlich auch nicht gemerkt. Wäre eine nutzlose geistige Investition gewesen.
Читать дальше