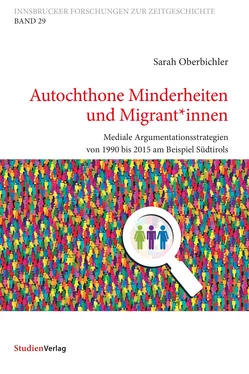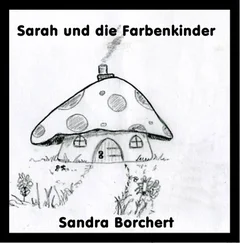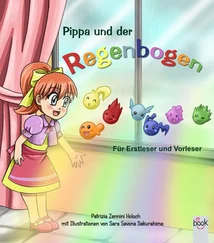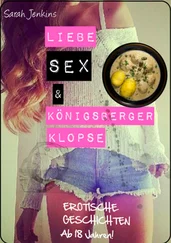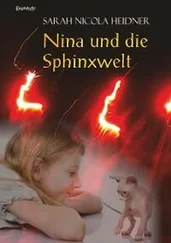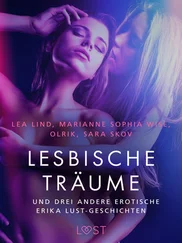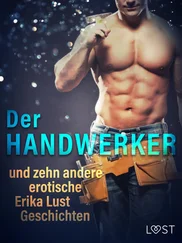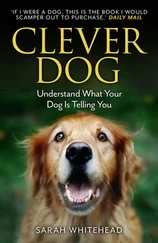Gegen diese Erkenntnis lassen sich aber auch Einwände einbringen. Viele der genannten Untersuchungen liegen bereits eine längere Zeit zurück und entsprechen nicht mehr den derzeitigen Vorkommnissen. Zudem klammern die meisten Untersuchungen aus, dass es sehr wohl eine positiv konnotierte Wahrnehmung von Migrant*innen in Medien gibt und vor allem in Tageszeitungen ein bewusst ausgewogenes Bild von Migrant*innen gezeichnet wird – ganz im Auftrag von Friedensstiftung und Friedenserhaltung.
Das heißt, Medien geben durchaus positive und vorurteilsfreie Nachrichtenmeldungen wieder, weshalb der Vorwurf an die Medien, sie würden das Thema Migration durchwegs problematisieren, etwas zu kurz greift. 85
Trotzdem muss auch die bewusste Fremdenfreundlichkeit in den Medien kritisch reflektiert werden. Bernd Scheffer 86 kritisiert in seinem Aufsatz, dass fremdenfreundliche Medienpraxis offenbar nur dann besonders effektiv zu sein scheint, wenn diese die fremdenfeindliche Praxis mit ihren eigenen Mitteln schlägt – sprich stark emotional besetzt und ähnlich unreflektiert ist. Denn auch hier gilt: Sensationalisierung, Polarisierung und Emotionalisierung verkaufen sich besser als die Darstellung eines normalen Alltags. 87 Anita Moser spricht in diesem Zusammenhang von positiver Diskriminierung. Migrant*innen werden dabei als gute und fähige Menschen dargestellt, die das Idealbild eines gut integrierten Menschen widerspiegeln. 88 Die Wahrnehmung von Migrant*innen als normaler Bestandteil der Gesellschaft ist durch die Rezeption von Medien nach wie vor nicht möglich.
Migrant*innen werden überrepräsentiert versus marginalisiert
Priska Bucher und Andrea Piga kommen in ihrem Aufsatz „Medien und Migration – ein Überblick“ 89 zum Fazit, dass Migrant*innen in Medien deutlich unterrepräsentiert sind, sprich zu wenig über Zugewanderte geschrieben wird. Auch Heinz Bonfadelli 90 und Margret Lünenborg 91 kommen zur selben Schlussfolgerung. Andererseits hebt Ruhrmann hervor, dass bestimmte ethnische Gruppen in den Medien deutlich überrepräsentiert werden. In diesem Zusammenhang nennt Ruhrmann Menschen türkischer Herkunft, über die in den 1980er-Jahren in deutschen Medien häufiger berichtet wurde als über Migrant*innen anderer Herkunft. Damit wurde eine verzerrte Häufigkeit von Migrant*innen gezeichnet. 92 Auch Gabriel Weimann 93 ist zum Schluss gekommen, dass bestimmte Gruppen von Zugewanderten in den Medien deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Diese Aufmerksamkeit richtet sich an erster Stelle gegen Gruppen, die als unerwünscht gelten. Dazu zählt Weimann Menschen türkischer Abstammung sowie Personen aus afrikanischen und arabischen Ländern.
Befunde von Analysen italienischsprachiger Medien deuten zudem auf eine Überrepräsentation von Migrant*innen in der sogenannten cronaca nera hin, sprich jenem Teil der Zeitung, in dem Verbrechen und Kriminalitätsfälle aufgelistet werden. 94 Beide Schlussfolgerungen, sowohl jene der Marginalisierung als auch jene der Überrepräsentation, stehen dabei nicht zwangsläufig im Widerspruch. In der bloßen Erwähnung sind Migrant*innen unterrepräsentiert, insbesondere in nicht problematisierenden Berichterstattungen. Zudem werden ihnen kaum Artikulationsmöglichkeiten zugestanden. 95 Diese passive Rolle, in die Migrant*innen durch Medien gezwängt werden, unterstreicht nach Ruhrmann und Sommer zudem die politische Einflusslosigkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte. 96 Medien tragen also deutlich dazu bei – so Erol Yildiz 97 – welche Diskurse dominant sind und in welchen Migrant*innen marginalisiert werden. So sind Migrant*innen etwa in bestimmten Diskursen überrepräsentiert – wie etwa im Kriminalitätsdiskurs –, und in anderen Diskursen – wie etwa Alltagsdiskursen – unterrepräsentiert. 98
Kritisch angemerkt werden muss jedoch, dass die Beurteilung der Repräsentation von Migrant*innen prinzipiell schwer objektiv festlegbar ist. 99 Viele Studien beschränken sich auf die Untersuchung der Wahrnehmung ganz bestimmter ethnischer Gruppierungen oder ziehen (problematische) Ereignisse als Untersuchungsgegenstand heran. Dies kann dazu führen, dass die Normalität, die durchaus auch in den Medien zu finden ist, verloren geht. 100
Kriminalisierung von Migrant*innen
Laut Bucher und Piga werden Migrant*innen nebst den Bereichen Wirtschaft und Politik häufig im Zusammenhang mit Kriminalität thematisiert, wohingegen über ihren Lebensalltag wenig berichtet wird. Ebenfalls Meldungen über geglückte Verständigung bzw. geglückte Integration fehlen vielfach. 101 Auch Geißler 102 und Ruhrmann 103 bestätigen die auffällig häufige Verbindung von Kriminalität und Migration und verweisen auf die Rolle der Ethnizität, die besonders in der Kriminalitätsberichterstattung über Migrant*innen eine Rolle spielt, auch wenn es dafür keinen augenscheinlichen Grund gibt. Susanne Spindler hält fest, dass Medien im Hinblick auf Kriminalität und Gewalt als Verkünder der öffentlichen Moral fungieren. Sie zeigen auf, was gut und was als böse zu beurteilten ist. Sie stellt dabei fest, dass abweichendes Verhalten von Zugewanderten häufig mit dem „Migrationshintergrund“ in Zusammenhang gebracht wird. 104 Analysen italienischsprachiger Zeitungen haben zudem ergeben, dass im letzten Jahrzehnt die Meldungen in den cronaca nera zugenommen haben und dass es einen großen Unterschied zwischen der Repräsentation von Kriminalitätsfällen und der realen Kriminalität von Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. 105 Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam auch Georg Ruhrmann 2005 in Bezug auf deutschsprachige Medien. Ihm zufolge hat sich das Thema Kriminalität in der Berichterstattung verdoppelt, obwohl sich die reale Kriminalität nicht in dieser Form entwickelt hat. 106
Christoph Butterwegge kam zur Schlussfolgerung, dass die Art und Weise, wie die Medien über Migrant*innen berichten, eine Hierarchie geschaffen hat, wonach bestimmte Gruppen von Ausländer*innen als Fremde, andere jedoch willkommen Gäste sind. In der Lokalpresse sei dieser Dualismus besonders stark ausgeprägt. Auf der einen Seite befinden sich die „Elitenmigration“, von der man sich generell Vorteile verspricht und auf der anderen Seite die „Elendsmigration“, die als überaus problematisch beobachtet wird. 107 Auch Susanne Spindler zeigt auf, dass positive Berichte oft in Verbindung mit „Expertenmigration“ stehen, sprich Migrant*innen, die für die lokale Wirtschaft gebraucht werden und somit einen Nutzen für die Gesellschaft darstellen. 108 Die als gute Migrant*innen wahrgenommenen Menschen werden jedoch strikt von anderen Zugewanderten getrennt, die als Gefahr für die soziale Sicherheit betrachtet werden. 109
Warum Medienanalysen einer Kontextualisierung bedürfen
Werden die Forschungsbefunde zum Thema Migration und Medien zusammengetragen, lässt sich feststellen, dass das Sprechen über Migration über die Grenzen hinweg – oberflächlich betrachtet – nach denselben Mustern verläuft. Man könnte selbst den Eindruck gewinnen, dass es keine Rolle spiele, im Rahmen welcher gesellschaftlicher sowie politischer Kontexte die Berichterstattung über Migration stattfindet oder wie viele Migrant*innen in einem Gebiet leben, in dem Medien über Migration berichten. Dies entspräche auch der gängigen Vorstellung, dass Medien neue Wirklichkeit und damit Nationalismus und Rassismus erzeugen.
Bezieht man jedoch die gesellschaftlichen und politischen Kontexte in die Analysen ein, so spiegeln sich in der Berichterstattung über Migration stets Denkund Argumentationsweisen wider, die in der Gesellschaft bereits existieren. Dies zeigt sich vor allem durch regionale Spezifika, die sich wesentlich auf das Sprechen über Migration auswirken. Das heißt, Gesellschaft, Politik und Medien bedingen sich – auch im Migrationsdiskurs – gegenseitig und gerade wegen lokaler Eigenheiten.
Читать дальше