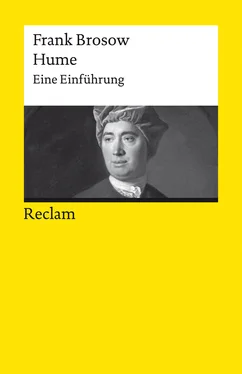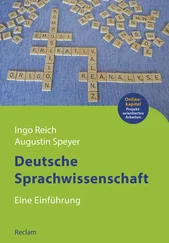Doch warum ist das so? Warum funktioniert das menschliche Denken gerade nach diesen Prinzipien? Nach Hume lässt sich diese Frage nicht mehr sinnvoll beantworten. Wenn wir die grundlegenden Prinzipien der menschlichen Natur erst einmal entdeckt, sie angemessen beschrieben und in ihrer genauen Funktionsweise erklärt haben, haben wir alles geleistet, was von einem Philosophen legitimerweise erwartet werden kann.
Das klingt einfach, erweist sich in der Praxis jedoch als durchaus kompliziert. Die drei Assoziationsprinzipien stellen zwar die unverzichtbare Grundlage des Denkens dar, stehen diesem zuweilen jedoch auch geradezu im Wege. Vor allem die Ähnlichkeit bringt uns immer wieder dazu, verschiedene Vorstellungen miteinander zu verwechseln. Besonders anschaulich lässt sich dies an folgendem antikem Paralogismus vorführen: »Keine Katze hat zwei Schwänze. Eine Katze hat einen Schwanz mehr als keine Katze. Also hat eine Katze drei Schwänze.«20 Die Erfahrung lehrt uns, dass das Ergebnis dieser Argumentation falsch sein muss. Doch wo genau liegt der Denkfehler? Frei nach Hume könnten wir sagen, er liegt in der [27]Verwechslung zweier einander ähnlicher Vorstellungen, die beide mit dem sprachlichen Ausdruck »keine Katze« assoziiert werden. Im ersten Satz meint der Begriff eine leere Menge ({ }), im zweiten eine bestimmte Anzahl (0) von Katzen.
Die Gefahr für den Philosophen liegt nun darin, dass die Verwechslung zweier Vorstellungen im Bereich philosophischer Theoriebildung oft nur schwer zu entdecken ist. Anders als in dem gerade behandelten Beispiel ist es im Fall von abstrakten Gedankengängen nur selten auf den ersten Blick offensichtlich, dass sie der Erfahrung widersprechen. Je allgemeiner und abstrakter die Vorstellungen sind, desto leichter werden sie miteinander verwechselt. Im schlimmsten Fall entstehen dabei Begriffe, die bei näherer Betrachtung vollkommen sinnlos sind, da sie keinerlei Bezug zur Erfahrung mehr aufweisen.
Hume schlägt daher ein Testverfahren für philosophische Begriffe vor: Wann immer wir den Verdacht hegen, dass ein bestimmter philosophischer Begriff bedeutungslos sein könnte, müssen wir uns fragen, auf welchem Eindruck die Vorstellung beruht, auf die er sich bezieht .21 Wenn sich kein solcher Eindruck finden lässt, haben wir es mit einem sinnlosen Begriff zu tun. Dies ist der Kern von Humes philosophischer Methode in nahezu allen Bereichen seiner Philosophie.
Begriffe wie »rot«, »Furcht«, »Pferd«, »rund« oder »Werkzeug« bestehen den von Hume vorgeschlagenen Test auf ihre je eigene Weise. Der im Zusammenhang mit Descartes bereits erwähnte Begriff der Substanz besteht ihn hingegen nicht. (Vgl. T 1.1.6.1–3; SBN 15–17.) Der Begriff »Materie« mag noch als allgemeine Vorstellung von körperlichen Dingen durchgehen. Doch da Descartes zwischen einer ausgedehnten und einer geistigen Substanz unterscheidet, müsste der Begriff der Substanz etwas bezeichnen, das sowohl körperlicher als auch geistiger Realität zugrunde liegt. Ein Eindruck, der als »Kopiervorlage« für eine solche Vorstellung dienen könnte, ist nicht zu finden. Wir [28]haben daher keinen Grund anzunehmen, dass es ein reales Etwas gibt, das die Bezeichnung als Substanz verdient.
Die Vorstellung des eigenen Ichs hat für Hume daher auch nichts mit einer immateriellen Seelensubstanz als Träger unserer Perzeptionen zu tun. Denn es lässt sich kein einzelner Eindruck entdecken, der der Vorstellung von einem Ich zugrunde liegen könnte. Der abstrakte Begriff »Ich« bezeichnet nach Hume vielmehr ein Bündel von Perzeptionen ( bundle of perceptions ), genauer gesagt diejenigen Eindrücke und Vorstellungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens perzipiert.22 Das Ich ist nicht das Theater, in dem die Perzeptionen als Schauspieler auf- und abtreten; es ist die Bezeichnung für die Gruppe der Darsteller, die Art und Weise und die Geschichte ihres Spiels. Denkt man sich die Schauspieler weg, so bleibt keine leere Bühne zurück, sondern gar nichts.23
Mit diesem Ansatz erteilt Hume der Substanz-Metaphysik seiner Zeit eine deutliche Absage. Die lange Zeit kontrovers diskutierte Frage, ob es nur eine einzige Substanz gibt, ob diese materiell oder immateriell ist oder ob es, wie die Dualisten meinen, eine materielle und eine zweite, von ihr verschiedene immaterielle Seelensubstanz gibt, kann und braucht nach Hume nicht beantwortet zu werden, weil es schlicht nicht sinnvoll ist, sie zu stellen.
In dieser Weise untersucht Hume mehrere zentrale Begriffe aus verschiedenen Bereichen der Philosophie wie »Kausalität«, »Freiheit«, »Schönheit«, »Tugend« oder »Gott«. Seine Ausführungen hierzu lassen sich stets als Antwort auf die Frage verstehen, welche konkreten Vorstellungen mit diesen allgemeinen Begriffen verbunden sind und auf welchen Eindrücken diese Vorstellungen letztlich beruhen.
So viel zunächst zum Bereich der Vorstellungen. Um Humes Testverfahren zur Rückführbarkeit von Begriffen auf die ihnen zugrunde liegenden Eindrücke richtig zu verstehen und sicher [29]anwenden zu können, ist es allerdings unabdingbar, sich vor der Auseinandersetzung mit konkreten Anwendungsbeispielen auch über die verschiedenen Arten von Eindrücken klar zu werden.
Eindrücke werden von Hume in primäre und sekundäre unterteilt. (Vgl. T 2.1.1.1; SBN 275.) Die primären Eindrücke ( original impressions or impressions of sensation ) entstehen, ohne dass ihnen andere Perzeptionen vorausgehen müssen. Zu den primären Eindrücken gehören Sinneswahrnehmungen ( sensations ), körperliche Lust- und Schmerzempfindungen, aber auch Gefühle wie Hunger oder Müdigkeit. All diese Eindrücke entstehen nicht aus Reflexion, sondern aus der Beschaffenheit unserer Natur. Die sekundären Eindrücke oder Eindrücke der Selbstwahrnehmung ( secondary or reflective impressions ) gehen hingegen entweder aus primären Eindrücken oder aus deren Vorstellung hervor. Zu ihnen gehören alle Affekte ( passions ).
Für die Affekte interessiert sich Hume in besonderem Maße. Er sieht in ihnen den Schlüssel zum Verständnis unseres Handelns und unserer Werturteile. Hume teilt sie hinsichtlich ihrer Intensität in ruhige ( calm ) und heftige ( violent ) ein. (Vgl. T 2.1.1.3; SBN 276.) Ruhige Affekte werden im Gegensatz zu heftigen eher an ihrer Wirkung als an ihrer Empfindungsqualität erkannt. Zu ihnen gehören zum Beispiel ästhetische und moralische Empfindungen, die Liebe zum Leben oder die allgemeine Bevorzugung des Guten gegenüber dem Schlechten. (Vgl. T 2.3.3.8; SBN 417.) Die Intensität eines Affekts darf nicht mit seiner Stärke verwechselt werden. (Vgl. T 2.3.4.1; SBN 419.) Wenn es zu einem Widerstreit zwischen ruhigen und heftigen Affekten kommt, können sich auch die ruhigen Affekte durchsetzen.
Das zweite Kriterium zur Unterscheidung der Affekte ist die Art und Weise ihrer Entstehung. Hier differenziert Hume [30]zwischen direkten ( direct ) und indirekten ( indirect ) Affekten. (Vgl. T 2.1.1.4; SBN 276 f.) Direkte Affekte wie Verlangen und Abneigung oder Hoffnung und Furcht entstehen unmittelbar aus Lust bzw. Unlust oder aus einem natürlichen, nicht näher erläuterbaren Instinkt. Nach Hume gibt es auch zwischen Eindrücken so etwas wie eine natürliche Assoziation, die anders als im Bereich der Vorstellungen allerdings nur auf dem Prinzip der Ähnlichkeit beruht.24 Diese Ähnlichkeit kann die Empfindungsqualität oder auch die Intensität betreffen. Der Geruch einer leckeren Speise weckt den Affekt des Verlangens, weil sich beide Eindrücke hinsichtlich ihrer positiven Empfindungsqualität ähneln. Andererseits wird heftige Liebe eher in heftigen Hass umschlagen als in Gleichgültigkeit.
Indirekte Affekte wie Stolz und Scham, Liebe und Hass oder Mitleid und Schadenfreude erfordern neben einem ihnen ähnlichen Affekt, der ihnen vorangeht, zusätzlich einen gedanklichen Gegenstand besonderer Art. (Vgl. T 2.1.2.4; SBN 278.) Die Entstehung dieser Affekte beruht nach Hume auf einem doppelten Impuls ( double impulse ; vgl. T 2.1.4.4; SBN 284.), nämlich einerseits auf einer Assoziation von Vorstellungen ( association of ideas ) und andererseits – wie die direkten Affekte – auf einer Assoziation der Gefühle ( association of impressions or emotions ). Wenn das Essen gut schmeckt, so reicht diese Tatsache allein noch nicht aus, um Stolz (in Humes Sinne) zu empfinden. Wenn Sie das Essen jedoch selbst gekocht haben, so werden Ihre Gedanken vom angenehmen Geschmack des Essens auf Sie selbst als dessen Ursache gelenkt. Erst aus diesem doppelten Impuls entsteht der Affekt des Stolzes. Überlegungen dieser Art werden insbesondere im Zusammenhang mit Humes Konzeption des moralischen Gefühls wichtig werden.
Читать дальше